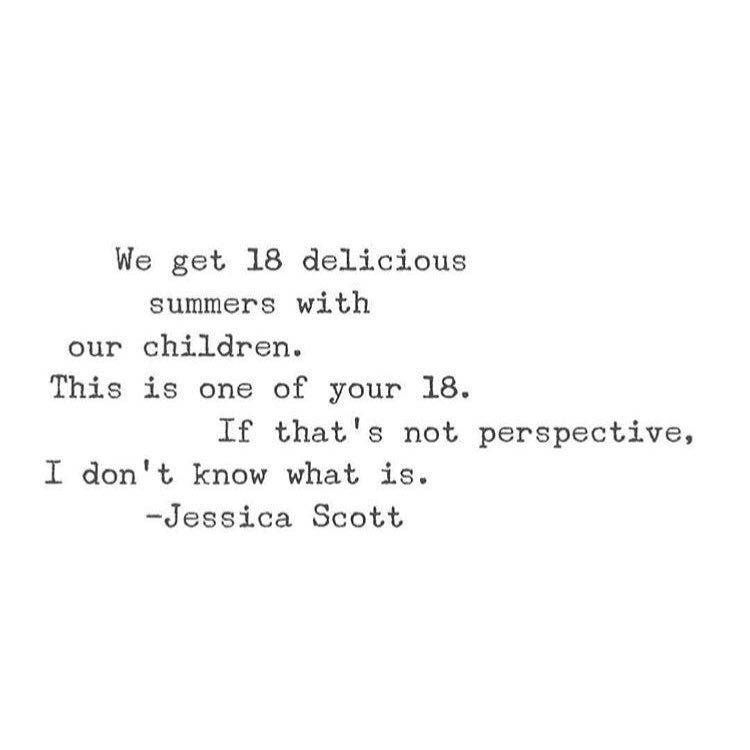Wie egoistisch dürfen Mütter sein?

Es ist etwa fünf Jahre her als ich mir das erste Mal die Frage stellte, ob ich denn nun bereit wäre, ein Kind in die Welt zu setzen. Feste Beziehung, gerade 30 geworden, spricht doch nichts dagegen oder? Ah ja stimmt, da war ja was: mein Egoismus, den ich einfach noch nicht bereit war, aufzugeben. Genauer gesagt mein „Laissez faire – Leben“ als Freiberuflerin, meine ausgedehnten Bar-Abende mit Freunden, die endlosen Sonntage im Bett. Alles in allem ein rundum selbstgestaltetes Leben, ohne ernsthafte Verpflichtungen. Freiheit olé, Kinder kriegen… ähm, ein andermal.
Zeitsprung – 5 Jahre später.
Anfang des Jahres werde ich schwanger, die Freude ist groß, die Ängste von damals bleiben. Muss ich mich nun von meinem alten Leben verabschieden? Werde ich jemals wieder Zeit für mich und meine Bedürfnisse haben? Hört man auf die erfahrenen Stimmen im Umfeld, lautet die Antwort schlicht und einfach „NEIN“. „Dein Leben wird nie wieder so wie es war!“, “Schlafen kannst du vergessen…” ebenso Ausgehen, Duschen und und und… Uff. Mit Schweißperlen auf der Stirn stelle ich fest, dass ich auf Babyknast mit Freigang und fettigen Haaren wenig Lust habe und suche nach Schlupflöchern.
Die erste eigennützige Handlung findet bereits zwei Wochen nach der Geburt statt. Meine Eltern sind zu Besuch in Berlin und ich nutze spontan die Gunst der Stunde, sie als Babysitter einzuspannen und feiere meinen Geburtstag. Klein aber fein, mit den engsten Freunden in einer Bar um die Ecke. Sicherlich nicht unbedingt typisch so kurz nach der Geburt, aber an dem Abend fühlt es sich genau richtig an. Für drei Stunden ICH sein – Herrlich. Angefixt von dem Duft der Freiheit, schaffe mir weiterhin kleine Freiräume im Baby-Alltag. Doch plötzlich meldet es sich, das schlechte Gewissen; „Wieso musst du denn jetzt in aller Seelenruhe deinen Insta-Account checken? Kuschel doch lieber mit deinem zuckersüßem Baby!“ Und sollte ich statt Kaffee mit Freunden zu trinken nicht lieber beim Pekip-Kurs sein? Könnte ich die Zeit für die morgendliche Badezimmerroutine inklusive Rouge und Wimperntusche sinnvoller nutzen? Und darf ich mich über purzelnde Schwangerschaftskilos genau so freuen, wie über Babys erstes Lächeln? Wieso sitze ich jetzt am Laptop und schreibe diese Zeilen, statt mir den Säugling nackig auf die Brust zu packen. Puh, einmal das Gedankenkarussell angeschmissen, hört es nicht so schnell auf sich zu drehen.
Woher kommt dieses schlechte Gewissen?
Mache ich mir wieder mal selber Druck oder kommt er von außen, frage ich mich? Freunde und Familie können es definitiv nicht sein, sie unterstützen mich und finden meine Herangehensweise sogar richtig gut. Was ist es also dann? Die Antwort ist am Ende so simpel wie gleichermaßen traurig: es handelt sich um ein veraltetes, gesellschaftliches Bild, das sich scheinbar irgendwo tief in meinem Kopf festgesetzt hat. Das Bild von Frauen, die immer ein bisschen leiden, um als Mutter perfekt zu sein. Von perfekt bin ich weit entfernt. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass eine fürsorgliche und liebevolle Mutter zu sein, nicht automatisch völlige Selbstaufgabe bedeutet. Wir werden nicht perfekter, wenn wir mental oder körperlich leiden. Selbstverständlich bekommen viele Dinge eine andere Wichtigkeit und die Bedürfnisse des Kindes stehen ganz klar an erster Stelle. Doch kommen direkt danach meine Eigenen. Denn schließlich ist es doch kein Geheimnis, dass sich die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit der Mutter auch auf das Kind auswirkt. Blicken wir nicht immer anerkennend rüber nach Frankreich, zu den aus dem Ei gepellten, Café au Lait schlürfenden, Vogue lesenden Frauen, die das Muttersein mit einer Leichtigkeit zelebrieren, wie kaum jemand anderes? Warum sich also nicht eine Scheibe davon abschneiden und sich jeden Tag ein bisschen feiern. Wie sich diese Selbstliebe äußert, bleibt jeder Frau natürlich selbst überlassen. Für die eine ist es ein Mal im Monat ein Besuch im Spa, für die nächste ein gutes Buch, das am Abend gelesen wird, anstatt die Waschmaschine einzuräumen. Und wieder andere brauchen den ganzen Bohei gar nicht und ziehen aus der Mutterrolle ihre absolute Befriedigung.
Wichtig ist nur, dass die Möglichkeit zur Freiheit bleibt. Ich will mir von absolut niemandem ein schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn ich meinen Bedürfnissen nachgehe. Und sicherlich bedarf es eines guten Netzwerks, Großeltern, helfenden Händen und natürlich eines tollen Vaters, um sich eben diese Freiräume zu schaffen. Doch liegt es an uns, sie auch einzufordern und sich weder dafür zu schämen, noch zu rechtfertigen.
Urteile nicht!
Noch viel wichtiger finde ich den letzten Punkt: nicht über andere Mütter zu urteilen, die ihre neue Rolle vielleicht anders angehen, als man es selber tut. Hier gibt es kein richtig oder falsch, nur das falsche Gefühl. Das habe ich jetzt schon verstanden – und hinterfrage meine Barabende mit Freundinnen nicht mehr. Trotz getrockneter Babykotze auf meinem Pullover bin ich in diesen paar Stunden ganz bei mir. Fernab von Babythemen und Windeln wechseln. Ich brauche diese Zeit, um festzustellen, dass sich mein altes und neues Leben wunderbar kombinieren lassen. Und sich am Ende des Tages vielleicht doch gar nicht so viel verändert hat, wie ich anfänglich befürchtet hatte.
Ich bin dieselbe Frau wie früher, mit dem einzigen Unterschied, dass ich bereits auf dem Heimweg ein sehnsüchtiges Kribbeln im Bauch verspüre.