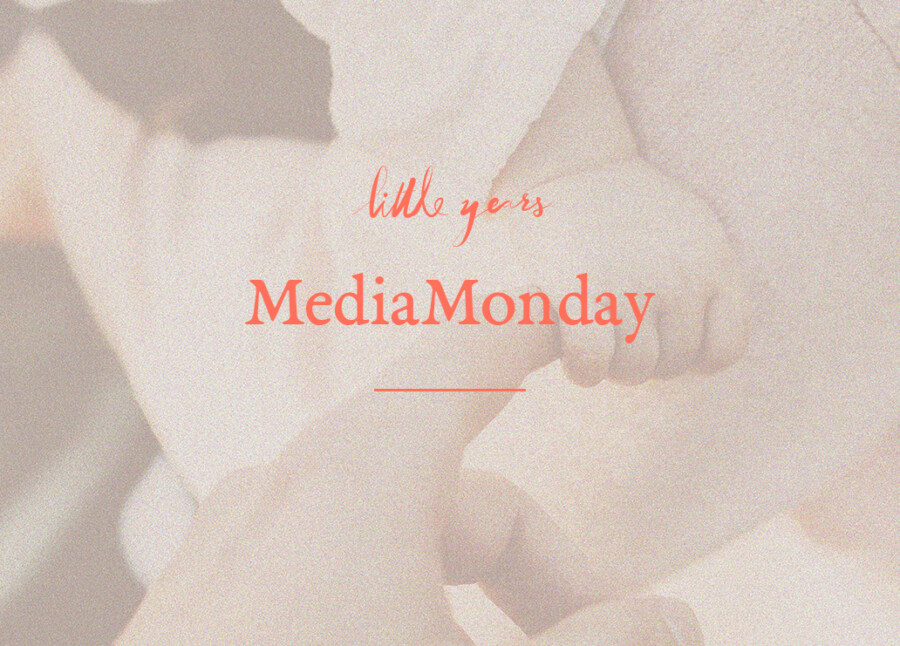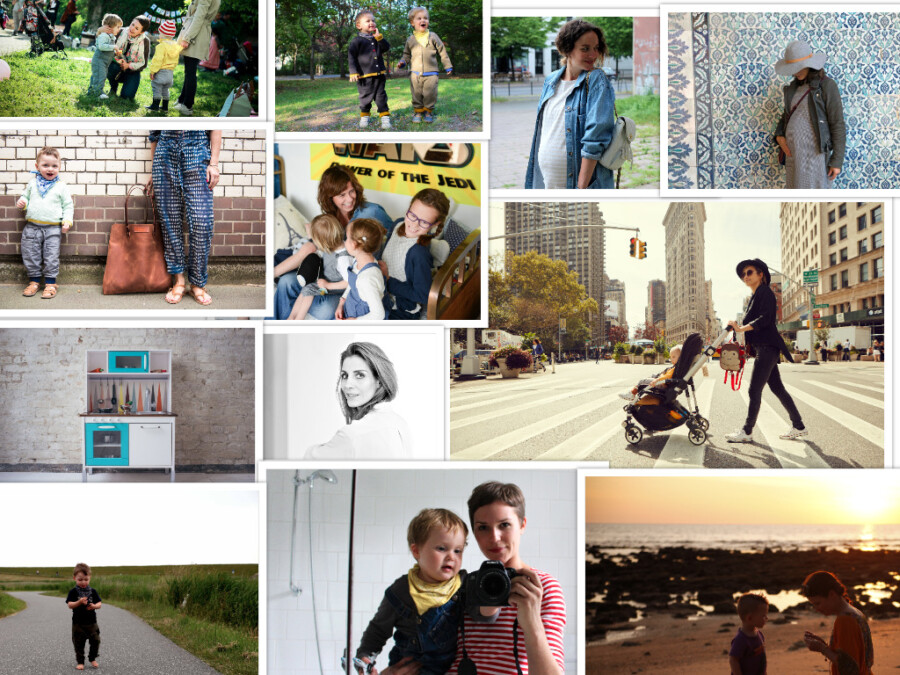Von (m)einer geplanten Hausgeburt (und warum sie nicht stattgefunden hat)

Legen wir los
Zwei schnelle Gedanken dazu: Ich hatte eine sehr schöne Geburt, aber sie verlief ganz anders als geplant.
Ich habe irgendwo hier im Blog bestimmt schon einmal darüber geschrieben, dass meine Schwangerschaft größtenteils so nebenbei gelaufen ist. Das lag zum einen sicher daran, dass sie sehr unproblematisch verlaufen ist – zum anderen aber auch daran, dass sie mitten in eine Zeit fiel, in der ich eigentlich total mit meinem Jobeinstieg beschäftigt war. Insofern machte ich mir eine ganze Zeit lang auch überhaupt keine (oder nur sehr wenige) Gedanken zum Thema Geburt. Die einzige Vorstellung von Geburt, die ich bis dahin hatte, fußte auf dem Auszug eines Berichts meiner Mutter, sie habe weder mitbekommen noch gespürt, als man sie unter meiner Geburt schnitt – und ich mir das partout nicht vorstellen konnte.
Ich weiß noch, wie ich letztlich am Ende des 9. Monats aus dem Korrespondentenbüro meiner Zeitung in den Mutterschutz wechselte, genau am Tag meines Umzugs nach Berlin mit meiner Kindergartenfreundin (die zu dem Zeitpunkt bereits zwei Kinder hatte) telefonierte und sie das Thema zum ersten Mal anschnitt. Ich hatte ihre Geburten ja mitbekommen. Zäh, lange und schmerzhaft müssen sie gewesen sein. Ich meine mich erinnern zu können, dass sie bei beiden Kindern über 30 Stunden in den Wehen lag. Dementsprechend viel unser Gespräch aus, es war gewisser Weise eine Warnung an mich, wie schrecklich so eine Geburt sein könne.
Ich kann mich aber auch erinnern, dass mich das wenig beeindruckte und sich trotzdem keine Angst einstellen wollte. Ich hatte die Schwangerschaft ja bis dahin als sehr selbstverständlich erlebt und war mir unmittelbar an dem Tag, als ich herausfand schwanger zu sein, sicher, dass mit diesem Kind alles gut sei.
Ausschlaggebender für die Idee, wie ich die Geburt erleben wollen würde, war letztlich wohl auch erst die Begegnung zu einer (heutigen) Freundin, mit deren Familie wir am Ende meiner Schwangerschaft viel Zeit verbrachten. Sie hatte beide Kinder als Hausgeburt zur Welt gebracht und es klang so selbstverständlich, so schön, so geborgen, dass ich mich auch unmittelbar mit dem Gedanken anfreundete.
Letztlich trugen dann auch sicher Filme wie “Business of Being Born” und “Babys” dazu bei, dass wir uns irgendwann festlegten, es zuhause probieren zu wollen. Und natürlich unsere Hebamme: die ich zwar auch erst im 9. Monat kennengelernt hatte – mit der aber gleich die Chemie stimmte und die rückblickend die allerbeste Begleiterin für uns war und ich sie immer wieder an meiner Seite haben wollen würde. Sie war warm, weich und wunderbar, recht alternativ zum Mainstream eingestellt, hatte ich damals den Eindruck, und bot uns um unser sehr knappes Budget wissend sogar an, uns für einen sehr kleinen Beitrag während der Hausgeburt zu begleiten.
Und dann kam es doch ganz anders
Ich wartete also die letzten Wochen der Schwangerschaft mich in Sicherheit wiegend. Ich kann mich gut erinnern, dass diese letzten Wochen mir – wie wohl den allermeisten Frauen allein ob all der Beschwerden zum Ende hin – schier unendlich vorkamen und dann auch irgendwann wurden, weil alle bereit waren, nur unser Sohn nicht. Ich glaube, ich habe mir das erste Mal Gedanken gemacht, ob das mit der Hausgeburt vielleicht doch nicht klappen könnte, als er eine Woche über dem ET immer noch nicht unterwegs war. Aber wir hatten ja auch noch eine Woche und die wollte ich in Absprache mit unserer Hebamme und meinem Frauenarzt auch noch abwarten.
Und dann war Julius 14 Tage drüber und von Wehen keine Spur. Mit meiner Hebamme hatte ich für abends einen Wehencocktail als letzten Versuch vereinbart, die Geburt in Gang zu bringen, aber dazu kam es dann gar nicht mehr, weil man mir im Krankenhaus mittags sehr eindrücklich vortrug, wie unverantwortlich das doch alles sei. Andauernd würden Frauen eingeliefert, die Wehencocktails getrunken hätten und davon sichtlich mitgenommen seien. Viel besser und verlässlicher wirke doch ein Medikament zur Einleitung der Geburt.
Ich kann mich erinnern, dass ich von der Person und Hebamme, die mir das im Krankenhaus so sagte (und die mich dann später ähnlich schroff auch entbunden hat), regelrecht eingeschüchtert war und dann einfach spontan einstimmte, die Geburt doch einleiten zu lassen (wenn ich auch heute weiß, dass das Medikament, das ich dann schließlich nahm, auch nicht anders wirkt als so ein Wehencocktail, der richtig dosiert ist – und beides seine Risiken hat).
Ich weiß auch noch sehr deutlich, wie unangenehm es mir gegenüber meiner Beleghebamme war, im Krankenhaus eingeknickt zu sein anstatt “unser” Ding zuhause und abseits der sich vermeintlich androhenden Krankenhausgeburt-Eskakade durchzuziehen.
Es gab dann auch lauter Eingriffe, aber irgendwie war das auch alles ok so.
Ich wurde also mittags eingeleitet und dann passierte erst mal lange nichts. Hier und da beschrieb das CTG Wehen, aber keine regelmäßigen. Also besuchten wir noch jene beschriebene Hausgeburts-Familie, gingen essen und dann irgendwann zurück ins Krankenhaus. Julius’ Vater fuhr abends nachhause und ich legte mich zum Schlafen hin. Und dann ging es einfach so los, mitten in der Nacht, um 1 Uhr. Ich nahm einen Moment an, dass es das schreiende Baby der Zimmernachbarin sein müsste, das mich nicht weiterschlafen ließ – obwohl ich eigentlich Schmerzen hatte, aber nicht begriff, dass das nun die Eröfnnungswehen waren. Letztlich kamen die “Schmerzen” dann aber so schnell hintereinander, dass ich nach einigen Runden realisierte, was da gerade passierte.
Ich bin dann, glaube ich, recht schnell raus auf den Flur der Wöchnerinnenstation, hab mir warmes Wasser für eine Wärmflasche geben lassen und saß dann mit genau der im Rücken und wippend (weil das half) auf einer Bank. Eine ganze Weile. 2 oder 3 Stunden etwa. Dass ich Wehen habe, schrieb ich an Julius Vater erst als die bereits alle 1 1/2 Minuten kamen (aber auch, dass es sicher noch dauern würde und er sich Zeit lassen könne), außerdem ein wenig Blut verloren hatte und mit diesem Befund beim Kreißsaal klingelte. Da war mein Muttermund schon auf 6 cm geöffnet.
Ich durfte an diesem Punkt sogar noch einmal im Flur vor dem Kreißsaal warten. Wieder mit der Wärmflasche im Rücken und Julius’ Vater neben mir, der dann doch schnell gekommen war. Mit dabei: die Hausgeburts-Freundin, die mich vorher gefragt hatte, ob sie vorbeikommen soll und mir unter der Geburt noch eine große mentale Stütze sein sollte.
Irgendwann sind wir dann wieder rein, weil es hieß, man wolle nochmal nach den Herztönen schauen und als die sich als auffällig herausstellten, war das Herumwandern- und sitzen schlagartig vorbei, durfte ich nur noch liegen. Ich weiß noch, dass ich mich regelrecht angeschnallt gefühlt habe und dass dieser Schritt total gegen mein Gefühl ging, mich bewegen zu wollen – ich ab dem Zeitpunkt, die Wehen schwieriger zu veratmen fand als vorher. Aber es ging. Die Herztöne von Julius wurden hingegen immer auffälliger, so dass dann irgendwann eine ganze Reihe Menschen im Raum standen, die Fruchtblase geöffnet wurde und ein Arzt zweimal Blut am Kopf meines Kindes abnahm, um zu testen, ob alles gut mit ihm sei.
Im Nachhinhein hat mir die Freundin erzählt, dass es in der Situation wohl durchaus Spitz auf Knopf stand und man mich wahrscheinlich in den OP geschoben hätte, wenn der Befund aus der Blutabnahme nicht gut gewesen wäre. War er aber und so durfte ich weitermachen – wenn auch immer noch ans CTG gefesselt und auf dem Rücken liegend bei 9 cm. Die allerschwierigste Phase unter der Geburt war dann – und wie vorher tatsächlich im Geburtsvorbereitungskurs beschrieben – die Übergangsphase, in der ich kurz dachte, die Schmerzen nicht mehr aushalten zu können – sie mich regelrecht überrollten, ich die Wehen kaum noch veratmen konnte, stattdessen wimmernd darniederlag, die Hand meiner Freundin drückend sagte, ich schaffe das nicht mehr lange und sie wie ein Mantra betend antwortete: es dauere nicht mehr lange, gleich sei alles vorbei.
Und dann ging es zum Ende auch recht fix: Es waren schon einige Presswehen, aber es ging auch gut voran (wenn auch der Hebamme nicht schnell genug, weil sie dann irgendwann schnitt, damit es schneller ginge – im Nachhinein aber sagte, mein Gewebe hätte das wahrscheinlich auch ohne Schnitt mitgemacht).
Es gibt in dieser finalen Szene genau ein Bild, an das ich mich auch heute noch sehr deutlich erinnere, und das ist, als Julius’ Kopf schon geboren war und er sich noch einmal wand, ehe die Hebamme ihn schließlich ganz herauszog und mir auf mir auf die Brust legte. Acht Stunden waren da vergangen und ganz dem Klischee gleich vergessen.
Ein Fazit
Ich glaube schon, dass ich am Ende der Geburt und von all den Filmen und Dokumentationen, die ich gesehen hatte, sehr radikal dachte, ich wolle das Krankenhaus auf jeden Fall vermeiden. Im Nachhinhein denke ich, dass Julius wahrscheinlich auch zuhause gut und gesund zur Welt gekommen wäre. Allein, weil ich dort noch viel mehr meinem Körper und meiner Intuition hätte folgen können, anstatt gerade zum Ende der Geburt nur liegen zu dürfen und Befehle anzunehmen (Sie dürfen nicht mehr aufstehen! Oder: jetzt pressen!).
Ich glaube aber gleichsam, dass meine Entscheidung, im Krankenhaus zu bleiben, ok war. Dass Julius’ Geburt auch ohne die Interventionen ausgekommen wäre – sie aber trotzdem genau so gut war wie sie letztlich abgelaufen ist, dass ich auch im Krankenhaus relativ gut bei mir bleiben konnte und seine Geburt auch unmittelbar danach als sehr schön erlebt habe. Ja, ich glaube, ich war kurz darauf regelrecht euphorisiert und dachte, doch nun eigentlich alles schaffen zu können, wenn ich dieses Kind geboren hätte. Und genau diesen Eindruck, den ich wünsche ich allen Frauen da draußen, meiner Schwägerin und meiner Freundin mit ihrem dritten Kind – weil so eine Geburt nicht vordergründig schrecklich sein muss, egal wo sie stattfindet. Sie kann uns Frauen – auch abseits des Kindes als größtes Geschenk – so viel geben, so viel in uns frei- und lostreten. Diese Geburt, sie war für mich regelrecht eine Emanzipation und hat mich als Frau in ein neues Bewusstsein für meinen Körper entlassen.