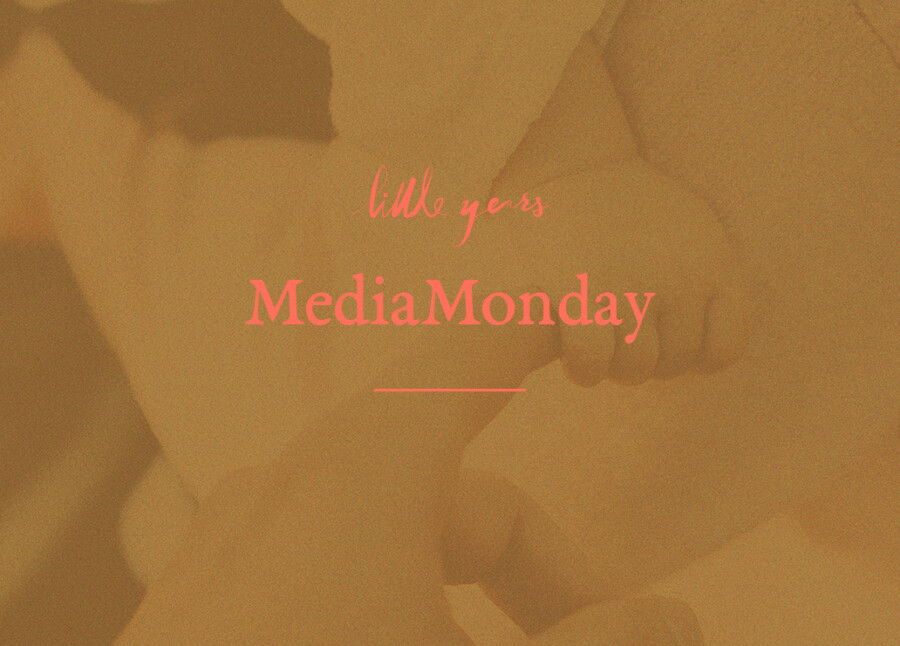Helikopter-Eltern: Sicherheit versus Eigenständigkeit
Aber es gibt da auch noch diese andere Ebene der Nachlässigkeit – oder wie befreundete und bekannte Eltern aus ihrer Perspektive mich im Umgang mit Julius vielleicht zuweilen erleben: als ein Sicherheitsrisiko.
Ich lasse Julius viel alleine vorlaufen und manchmal sogar warten, ohne dass ich ihn dabei immer hundertprozentig im Blick hätte. Den Bürgersteig entlang bis zur Kreuzung, die Treppe runter in den Hinterhof, die Treppe rauf in die Garderobe der Kita – während ich unten noch das Fahrrad abschließe. Wenn er sich ein Eis kaufen will, setze ich mich inzwischen häufig schon neben die Bank am Eisladen, drücke ihm eine Münze in die Hand und lasse ihn im Geschäft alleine bestellen.
Ich mache das alles, weil ich darauf vertraue, dass mein Kind nur das tut, was nicht gefährlich für ihn ist und er mich im Zweifel schon fragen würde, wenn er sich etwas nicht zutraute. Jean Liedloff hat in ihrem Buch “Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit” einmal beschrieben, wie die Kinder in Naturvölkern selbst sehr jung, die Risiken ihres Umfeldes sehr genau einzuschätzen wissen – ein Baby deshalb keine Klippe hinunterstürzt und auch nicht so einfach ins Wasser läuft – bzw. erst dann, wenn es schwimmen kann. Aber auch Kleinkinder, die viel selbstständiger sind – weil die Erwachsenen sie sich selbst erfahren lassen.
Sie schildert weiter, dass die eigentliche Gefahr darin bestünde, wenn Kinder ihres Potenzials beraubt würden, Situationen aus ihrer Intuition gut einschätzen zu können. Wenn wir als Eltern unsicher sind und diese Unsicherheit auf unsere Kinder übertragen, werden auch sie unsicher – und daraus ergäben sich dann die Unfälle, sagt sie.
Denn wenn ich eines nicht will, dann, dass mein Kind in dem Bewusstsein aufwächst, die Welt sei per se ein gefährlicher, schlechter Ort.
Julius und ich gehen morgens häufig zum Beispiel in Gesellschaft eines kleinen Jungen und seines Vaters zur Kita. Und wir Eltern könnten nicht kontroverser sein und handeln während dieses Weges. Während Julius losrennt und ich ihn laufen lasse, ruft der uns begleitende Vater schon meist nach wenigen Metern, wenn sein Sohn meinem Sohn folgt: Stopp! Oft geht er dann nach, kniet sich neben seinen Sohn und erklärt ihm, warum er nicht will, dass sein Sohn ohne ihn den Bürgersteig runter läuft. Das Argument ist immer: Sicherheit.
Ich bin ja sehr dafür, dass jeder so macht wie er meint und zwar innerhalb seiner Realität und seinen Lebensumständen, aber wenn dann Sätze wie folgender fallen, zucke ich innerlich doch ein wenig zusammen: „Wenn du um die Ecke rennst und ich dich nicht mehr sehe – dann ist das gefährlich. Vielleicht ist da ja jemand, der dich klauen will.“
Warum finde ich diesen Satz schwierig? Weil er – wie ich meine, und klar, ist das nun mein eigenes Erleben – wenig mit den äußeren Umständen, Bedingungen zu tun hat, als vielmehr mit dem Erleben des Vaters. Wir wohnen am Kollwitzplatz in Berlin Prenzlauer Berg – also quasi im reiche-weiße-Kinder-und-deren-Eltern-Ghetto. Klar, ist hier nicht auszuschließen, dass irgendwas passiert, aber das kann eben immer und überall so sein, denke ich und versuche mich zu entspannen. Denn wenn ich eines nicht will, dann, dass mein Kind in dem Bewusstsein aufwächst, die Welt sei per se ein gefährlicher, schlechter Ort.
Ohnehin glaube ich, dass es in dieser Situation viel mehr um den Vater geht, als um seinen Sohn: Dass der Vater hier wahrscheinlich mit Ängsten konfrontiert ist, die ihn selbst bestimmen – die er selbst woraus auch immer entwickelt hat. Um es plastischer auszudrücken: Wie der Erwachsene, der schreiend vor der Spinne wegrennt und damit seine Phobie auf sein Kind überträgt.
Wie ich als Kind einmal in der Kita verschwand
Meine Mutter erzählt gerne die Geschichte, wie ich eines Tages mit vier Jahren aus der Kita ausbüchste und mehrere Kilometer alleine durch Wuppertal zu uns nach hause lief, sie mich dort – nachdem sie mich drei Stunden verzweifelt mit den Erziehern gesucht hatte – auf der Treppe wartend fand. Der Weg von der Kita zu uns nachhause war sicher kein komplizierter, führte aber unter anderem an einer großen Bundesstraße entlang.
Gut, es gibt sicher Grenzen und die Geschichte meines vierjährigen Alter Egos ist sicher extrem. Ich würde mutmaßlich viele innere Tode sterben, wenn mir das mit meinem Sohn passierte. Julius ist vor ein paar Tagen zum Beispiel vom Spielplatz runter und hinter einer Hecke verschwunden. Wieder ein sehr ruhiger Nachbarkiez. Ich habe erst einen Moment gewartet, ob er vielleicht wieder zurückkommt. Aber das tat er nicht und ich ahnte schon warum: Er wollte wohl Aufmerksamkeit. Ich hatte mich eine ganze Weile mit einem Freund unterhalten und Julius immer wieder dazwischengerufen, dass er „nachhaaaauuuuuse“ wolle. Als ich ihm dann schließlich nach ein, zwei Minuten, nachdem er aus meinem Blick geraten war, hinterher bin, stand er der nächsten Straße nicht fern. Aber: Er stand auf dem Bürgersteig und nicht auf der Straße, weil er mit 4 Jahren sehr wohl weiß, dass das keine gute Idee wäre. Zumindest vertraue ich darauf. Eine absolute Versicherung darauf gibt es wohl nicht.