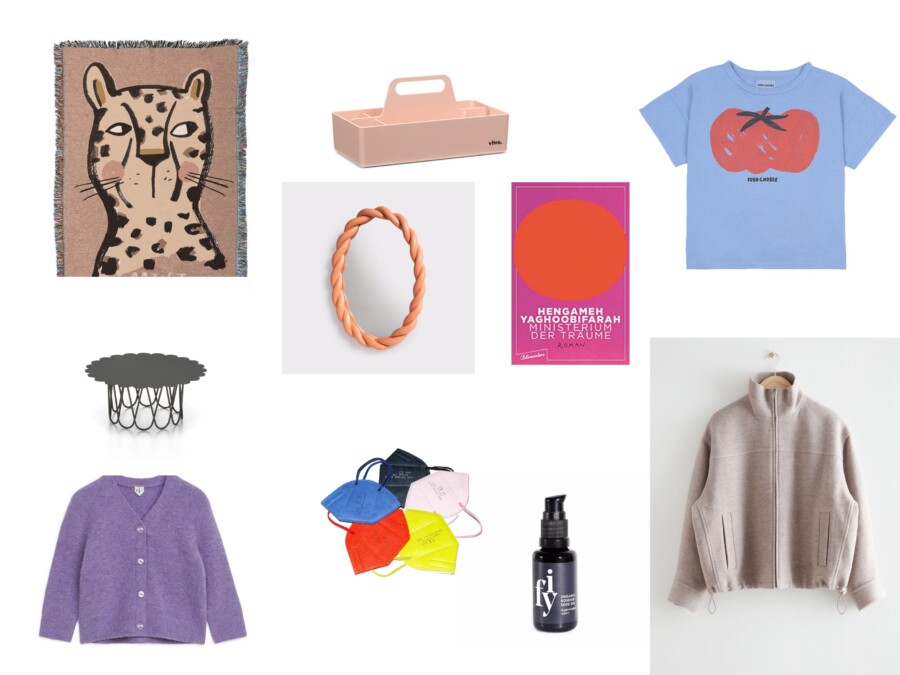Anfang 2020 hätte ich vom Mamasein und dem damit verbundenen Muttermut nicht weiter entfernt sein können. Dachte ich. Aber dann wurde es März und ich lernte zu Beginn der Pandemie meinen Mann kennen. Es dauerte etwa 70 Minuten beim ersten Date, bis uns klar wurde, dass wir nicht nur einen Kinderwunsch teilen – sondern auch einen Familienwunsch. Das sind zwei unterschiedliche Empfindungen, was viele Menschen leider zu spät bemerken. Zuvor hatte ich mir manchmal ausgemalt, wie es wohl sei, ein Kind auf die Welt zu bringen, es im Arm zu halten und so unbegreiflich viel für einen so unbegreiflich winzigen Menschen zu empfinden.
21st Century Mom: Eine Ode an den Muttermut

Aber ich war gerade 27 Jahre alt, hatte einen interessanten Job, tanzte auf vielen Festen und fing gerade erst damit an, ein Gespür für mich und die Welt da draußen zu entwickeln. Eigene Kinder zu bekommen erschien mir irgendwie egoistisch, außerdem war mir dieser klassische Ablauf Mann-Ring-Kind-Familie-Haus-Baum zu spießig und zu riskant. Die Scheidungsrate in Deutschland stieg seit Jahren und ich verbrachte mein halbes Jurastudium damit, komplizierte Fälle zwischen Menschen aufzudröseln, die sich irgendwann mal liebten und dann sehr, sehr viele Fehler machten.
Doch die Pandemie wirkte bei mir wie ein Brennglas für verborgene Lebensträume. Während andere Sauerteig ansetzten oder endlich die Kammer im Flur entrümpelten, wuchs in mir ein Wunsch nach einer heilen Welt und einem Zuhause, das mit Kindergeschrei, frisch gebackenem Kuchen, einer intakten Beziehung, Liebe und ein paar Tieren gefüllt ist. Dieser Wunsch war vorher abstrakt, ein Lebensentwurf, den ich mir hätte vorstellen können, neben anderen Lebensentwürfen ohne Kinder, die ich mir auch hätte vorstellen können. Aber da war nichts, was den Ausschlag gegeben hätte. Doch dann fühlte ich mit meinem Mann diese arrogante Energie frisch Verliebter, denen die Welt zu Füßen liegt, alles schien möglich, alles konnten wir schaffen. Wir zogen durch die Lockdown-Straßen und tranken sehr viel Moscow Mule, während wir immer wieder um diese eine, große Entscheidung herum taumelten.
Diese arrogante Energie frisch Verliebter, denen die Welt zu Füßen liegt.
Eigentlich mag ich solche Situationen gerne. Es macht mir Spaß, mich schnell für oder gegen etwas zu entscheiden und dann währenddessen rauszufinden, wie klug das war. Tendenziell treffe ich deswegen auch häufiger Fehlentscheidungen, aber das stört mich nicht. Ich finde das Abenteuer hinter einer schnellen Entscheidung so viel spannender, als mir Zeit zu nehmen, nüchtern abzuwägen oder erst mal in Ruhe abzuwarten. Trotz meiner ausgeprägten Entscheidungsfreude wusste ich bei dieser Frage, dass es die weitreichendste, einschneidendste Entscheidung meines Lebens sein würde. Gegen meine sonstige Gewohnheit sprach ich deshalb mit Freundinnen, die schon ein Kind hatten, weil ich glaubte, abwägen und überlegen zu müssen. Wenigstens ein Mal. Bei dieser einen, größten Entscheidung. Mir schwirrte immer wieder dieser Spruch „zum Leben braucht man Zeit“ durch den Kopf. Auch, weil ich ahnte, wie sehr diese Entscheidung meine Lebensrichtung verändern würde. Was fühlt sich richtig an und wo sehe ich mich? Ich bin schon immer am liebsten allein, wie wichtig ist mir dieses Alleinsein, wenn es drauf ankommt?
Berlin ist eine Bühne für verschiedenste Lebensentwürfe. Man sieht Momentaufnahmen von glücklichen Familien in der Bahn auf dem Weg nach Hause, von schweigenden Paaren, von Singles, die durch die Nacht tanzen, von gestressten Eltern, die ihr Kind anbrüllen, von einsamen Rentnern, die man am liebsten in den Arm nehmen würde. Diese Momentaufnahmen waren für mich oft Vergleichsmuster, mit denen ich mir überlegte, wie wohl mein Leben aussehen würde, irgendwann. Würde ich mich wieder erkennen, wenn ich mir begegnen würde? Würde ich mich beneiden oder mir leid tun? Und woran erkennt man überhaupt, ob eine Lebensentscheidung richtig war? An den Extremsituationen, an den Höhen und Tiefen oder am Durchschnittsalltag? Schade, dass man für so große Entscheidungen nicht zwei oder drei Test-Leben hat. Simulationen wie bei Sims, wo man erst mal schauen kann, wie cool man die Zahnpastareste im Waschbecken findet und sich dann doch für die andere Simulation allein, mit Katze und kleiner, gemütlicher Dachgeschosswohnung entscheidet.
Schade, dass man für so große Entscheidungen nicht zwei oder drei Test-Leben hat.
Eine Freundin meinte zu mir, dass sie mir die Mutterschaft nicht empfehlen könne – aber ihr Kind trotzdem null bereue und sich nochmal genau so entscheiden würde. Das hörte sich widersinnig an, aber es half mir, zu verstehen, dass man zum Leben und Leben schenken nicht nur Zeit, sondern vor allem auch Mut braucht. Muttermut. Dieser Muttermut kostet Kraft, weil es nicht nur die Entscheidung für eine Schwangerschaft, ein Kind oder die Familie ist. Im Zweifel ist es der Moment, in dem man sich mindestens temporär in die Abhängigkeit des Partners oder der Partnerin begibt, ein Wagnis, das oft schief geht und zu enormen Verletzungen führen kann. Auch finanziell ist es eine Entscheidung, die gerade Frauen häufig in ein Abhängigkeitsverhältnis und in eine wirtschaftlich schlechtere Ausgangslage als zuvor bringt. Vor allem ist es aber die Entscheidung gegen viele andere Lebensmodelle. Ein Leben mit sich selbst, allein und in völliger Unabhängigkeit. Ich kann die Schönheit in diesem Lebensentwurf gut verstehen. Ohne Einschränkungen zu arbeiten, zu reisen oder sein Leben mit anderen Leidenschaften zu füllen, ist verlockend. Niemand vermittelt einem das Gefühl, man sei verantwortlich. Auf der anderen Seite riskiert man Einsamkeit und belastende Fragen aus dem Umfeld, ob man sich denn nicht mal Jemanden suchen möchte. Beide Modelle haben ihren Reiz und ihre Tücken. Mir war klar: Egal wie es ausgeht, sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden, ist beides grundsätzlich verdammt mutig. Beides sind für mich Formen des Muttermutes, und beides verdient den gleichen Respekt. Als Frau schwingt natürlich auch noch mit, dass wir so lange keine Wahl hatten. Es ist eine Errungenschaft des späten 20. Jahrhunderts, sich einigermaßen frei entscheiden zu können, und das auch nur in einigen Teilen der Welt. Wie befreiend diese schwierige Wahl unter diesem Aspekt erscheint.
In den letzten Wochen sind meine Gedanken bei all den Menschen mit Gebärmutter, die keine Wahl haben, weil sie schwanger werden und der Staat ihnen ihren Muttermut nicht zutraut. PolitikerInnen die in Polen, den vereinigten Staaten, in weiten Teilen Südamerikas und an so vielen anderen Orten auf der Welt gesetzlich festlegen, dass Muttermut keine private Entscheidung ist. Ich denke an Norma McCorvey, besser bekannt als Jane Roe, die sich 1973 mit 22 Jahren, nach zwei Kindern für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden wollte. Im damaligen Texas war das illegal, also nahm sie all ihren Muttermut zusammen und klagte. Sie gewann und schuf mit diesem amerikanischen Grundsatzurteil einen Fall, der unfassbar vielen Menschen die Freiheit schenkte, eine schwierige, lebensverändernde Entscheidung selbst treffen zu dürfen.

Mir blutet das Herz bei dem Gedanken, dass nun, knapp 50 Jahre später, von einem überwiegend männlichen Supreme Court entschieden wurde, dass diese Freiheit illegal ist. Papst Franziskus verglich Abtreibungen jüngst mit Auftragsmorden. Und auch hier in Deutschland gibt es Politiker wie Jens Spahn, der 2018 auf die Idee kam, Frauen zu erklären, dass die Pille danach kein Smartie ist. Alle eint das große Misstrauen in den Muttermut, in Verbindung mit dem Wunsch nach Kontrolle über Körper, die nicht ihre eigenen sind. Meine Gedanken sind bei allen Menschen, die täglich unter den Entscheidungen dieser Leute leiden müssen. Ich kann mir nur in Ansätzen vorstellen, wie einschneidend ein Leben mit Kind für Menschen ist, die sich dazu nicht frei entscheiden konnten. Es ist ungeheuerlich, Menschen mit Gebärmutter diese Wahl nehmen zu wollen, gerade weil ein Kind das eigene Leben so grundlegend verändert.
Das große Misstrauen in den Muttermut, in Verbindung mit dem Wunsch nach Kontrolle über Körper, die nicht ihre eigenen sind.
Mitten in der ersten Herbstwelle der Pandemie, war da bei mir plötzlich ein zweiter Strich auf einem Test. In einer Zeit, in der ständig Leute über positive Tests fluchten, waren wir aus dem Häuschen vor Freude. Und da war sie also, meine Chance, mich tatsächlich zu entscheiden. In meinem Fall war es eine Entscheidung für das Baby. Mit meinem heutigen Mama-Wissen und vor allem meinem Mama-Gefühl wäre mir diese Entscheidung wahrscheinlich leichter gefallen, damals war ich durchaus ehrfürchtig. Trotzdem gab es bis jetzt keinen Tag, an dem ich meine Wahl bereut habe. Es ist anstrengend, kräftezehrend und manchmal vermisse ich es, Langeweile zu haben. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass ich damals die für mich beste Entscheidung meines Lebens getroffen habe.
Als mein Baby im Juli 2021 auf die Welt kam, habe ich noch im Krankenhaus ein Video aufgenommen, in dem ich mir selbst versprechen musste, nicht alle Menschen in meinem Umfeld zu Kindern zu überreden, so glücklich war ich über meine Entscheidung. Ich glaube wirklich, dass Kinder bekommen für viele Menschen das Beste ist, was sie machen können – und trotzdem verstehe ich meine kinderlosen Freundinnen gut. In ihrer Entscheidung gegen ein Kind steckt für mich genau so viel Mut, wie in meiner Entscheidung dafür. Uns eint die Selbstbestimmung, mit der wir unser Leben gestalten, in einem Land, das uns glücklicherweise eine Wahl lässt.
Die Entscheidung für oder gegen ein Kind ist privat, manchmal unfreiwillig und außerhalb jeder Bewertung.
Muttermut und der Mut, keine Mutter zu sein, beides ist aus dem gleichen Holz.

Fotos: Julia Zoooi