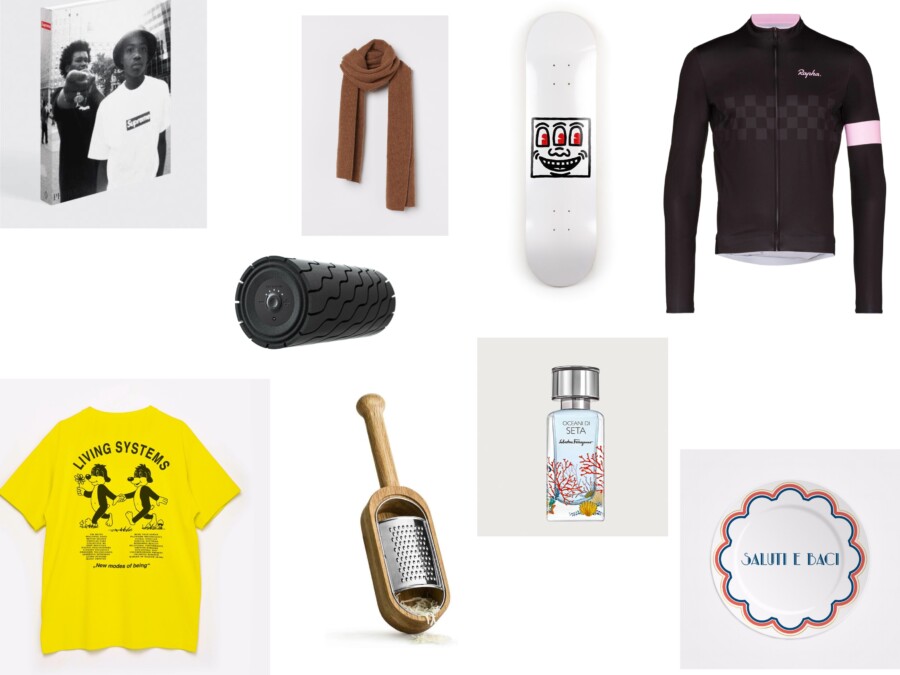Felicitas kennt ihr bereits aus unserem Porträt und ihrem Gastbeitrag “Finding me in motherhood” – heute teilt sie eine sehr persönliche Geschichte mit uns. Und macht damit den Anfang in unserer “kleine Geburten”-Serie.
Felicitas und ihre kleine Geburt – stiller Verlust und ein “Windei”

Der Wunsch nach einem zweiten Kind bestand für mich jahrelang nicht. Auch wenn ich die ersten Jahre mit meiner Tochter in vollen Zügen genoss, fühlte ich mich doch als Mama komplett ausgelastet. Während sich andere Frauen in meinem Umfeld bereits ein, zwei Jahre nach dem ersten Kind wieder nach einem schwangeren Bauch und einem Neugeborenen sehnten, war ich durchaus zufrieden mit unserer Familienkonstellation. Einerseits wünschte ich mir sehr, dass meine Tochter nicht wie ich als Einzelkind aufwachsen würde, aber bereit für den Sprung von einem auf zwei Kinder war ich noch lange nicht. Doch dann änderte sich alles ganz plötzlich.
Es war Januar 2014 und ich lebte in New York. Das Telefonat mit meiner besten Freundin in Deutschland werde ich niemals vergessen: „Ich muss Dir was sagen“, sammelte ich all meinen Mut zusammen. „Ich auch“, kündigte sie an. „Du zuerst“, forderte ich sie auf. Ihre Worte, „Ich bin schwanger“, trafen mich wie ein Schlag. „Ich auch“, teilte ich ihr mit, und so sachlich wie möglich fügte ich hinzu: „Der Embryo ist allerdings nicht überlebensfähig bzw. es ist gar keiner da. Ein Windei.“ – Stille –„Bist du sicher?“ – „Ja.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits Wochen des Grauens hinter mir. Diese Schwangerschaft war nicht geplant, aber von dem Moment, in dem ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, doch sehr erwünscht. Das war Anfang Dezember. Natürlich erzählten wir es auch sofort unserer Tochter. Was sollte schon passieren, dachte ich. Die Schwangerschaft mit meiner Erstgeborenen war schließlich komplikationsfrei verlaufen. Ich war kerngesund und ernährte mich vorbildlich – die besten Voraussetzungen, oder nicht?
Ich doch nicht!
Aber unterschwellig hatte ich doch ein mulmiges Gefühl und vereinbarte einen Termin für einen Ultraschall. In den vorherigen Wochen hatte ich in meiner örtlichen „Mama Meet-up Gruppe“ unter der Überschrift „The Silent Loss” eine Flut von Erfahrungsberichten zum Thema Fehlgeburt gelesen. Die einzelnen Schicksale gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein Ultraschall sollte also bestätigen, dass ich mich nicht in die Reihe dieser Frauen eingliedern musste. Das war zumindest mein Plan. Natürlich kam alles anders.
Es folgten unzählige Ultraschall- und Blutuntersuchungen. Zunächst vermuteten die Ärzte, dass die Schwangerschaft weniger weit fortgeschritten war, als ich angab. Doch von Termin zu Termin wurde klarer, was ich von Anfang an befürchtet hatte: Es wuchs kein gesundes Baby in meinem Körper heran. „Windei“ war die Diagnose. „Was für ein unsensibler, beschissener Begriff“, dachte ich. Die Adventszeit begann. Weihnachten und Silvester kamen und gingen. Mein Körper produzierte weiterhin fast vorbildlich Schwangerschaftshormone und die leere Fruchtblase wuchs und wuchs. Was für eine Farce! Einen operativen Eingriff wollte ich unbedingt vermeiden. Deshalb ging ich zur Akupunktur, nahm homöopathische Mittel und schluckte Kräuter, in der Hoffnung, dass mein Körper das Memo bekommt und die Schwangerschaft abstößt. Krämpfe und Übelkeit bekam ich, doch sonst nichts. Mit einem Körper voller Schwangerschaftshormone und einem leeren Mutterleib fühlte ich mich gelähmt und elend wie nie zuvor. Die emotionalen Auswirkungen von Hormonen waren mir bis dato nicht bewusst. Auf rationaler Ebene verstand ich, dass fast jede dritte Schwangerschaft mit einem Abort endet. Ich verstand genauso, dass es nicht meine Schuld war, sondern eine Laune der Natur oder vielmehr der Gene. Doch die Emotionen behielten die Überhand und ich fühlte mich gefangen in meinem eigenen Körper.
Am Ende der Eingriff
Zwei Tage vor meinem Geburtstag im Februar, kurz vor der 12. Schwangerschaftswoche, gab ich den Kampf gegen meinen Körper auf und willigte in einen medizinischen Eingriff ein. Im Nachhinein denke ich, dass ich dies viel eher hätte machen sollen, denn nach der Operation fielen die Hormonwerte rapide ab. Nach nur wenigen Tagen konnte ich endlich wieder klarere Gedanken fassen. Zum ersten Mal seit nun zwei Monaten.
Was dann kam, waren ein inniger Wunsch nach einer gesunden Schwangerschaft, ein komplett durcheinander gebrachter Hormonhaushalt und ein für mich sehr typischer Drang, umgehend wieder die absolute Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Der Kontrollfreak in mir machte das Projekt „Schnell-wieder-schwanger-Werden” zur Priorität Nr. 1. Und somit verbrachte ich das Frühjahr 2014 damit, noch mehr Akupunktur über mich ergehen zu lassen, um meinen Zyklus wieder zu regulieren. Darüber hinaus stürzte ich mich in die Arbeit und in die Vorbereitungen unseres bevorstehenden Umzuges nach Kalifornien.
Während dieser Zeit verlief die Schwangerschaft meiner Freundin glücklicherweise komplikationsfrei. Auch wenn ihre Meilensteine eine ständige Erinnerung an meinen Verlust waren, schaffte ich es immer wieder, genug Mut und Nerven für das nächste Telefonat zu sammeln. Oft brach ich nach unseren Gesprächen zusammen, doch ich gab mir große Mühe, so viel Anteil zu nehmen und mitzufiebern wie ich aus der Ferne nur konnte. Denn ich wollte partout vermeiden, dass mein Verlust unsere Verbindung in dieser für sie so besonderen Zeit negativ beeinträchtigte.
Zeit…
Im Sommer, kurz nach dem Umzug in die Sonne, sagte mir eine, wie sich im Nachhinein herausstellte, wohl sehr weise Hebamme, dass der weibliche Körper nach einem solchen Verlust oft emotional weiterhin an einer Schwangerschaft festhält. Ich solle doch mir und meinem Körper Zeit bis nach dem ursprünglichen Entbindungstermin geben. Ich fand diese Theorie faszinierend. Und siehe da, der Entbindungstermin brachte nochmal eine Welle von Emotionen mit sich, aber dann begann ein neues Kapitel. Wie es das Schicksal so wollte, war mein Sohn bereits ein paar Monate später unterwegs. Die Schwangerschaft mit ihm verlief ohne Komplikationen, auch wenn ich jetzt natürlich längst nicht mehr so gelassen war. Besonders das erste Trimester war aufgrund der ständigen Angst, ihn zu verlieren, sehr qualvoll für mich. Doch sobald ich sein Leben in mir spüren konnte, rückte die Angst immer mehr in den Hintergrund.
Und so war auch mein zweites Kind ein ersehntes Wunschkind, was ich mir zuvor partout nicht hatte vorstellen können. Heute denke ich oft, dass alles vielleicht genau so kommen sollte. Kinder, die nach einem Schwangerschaftsverlust zur Welt kommen, werden übrigens liebevoll „Regenbogenbabys” genannt. Mir gefällt dieser Begriff sehr, schließlich symbolisiert der Regenbogen das bewundernswerte Naturschauspiel, wenn nach einem Regenschauer oder Gewitter die Sonne wieder scheint. Die Ankunft meines Sohnes hat mich wahrhaftig von dem Trauma der Fehlgeburt befreit. Dennoch vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht an das verlorene Baby denke oder schnell mal nachrechne, wie alt sie oder er jetzt eigentlich wäre.
Meiner Tochter erklärte ich damals so kindgerecht und zugleich unverblümt wie möglich, dass unser Baby leider nicht in meinem Bauch bleiben konnte, und dass ich deshalb so traurig war. Dies schien in ihrer kleinen Welt Sinn zu machen, denn sie stellte keine weiteren Fragen. Mittlerweile hat sie nicht mal mehr Erinnerungen an diese Zeit. Doch wenn sie älter wird, werde ich ihr davon erzählen. Schließlich gehören Verluste zum Leben und Fehlgeburten, so schmerzhaft sie oft sind, zum Leben einer Frau dazu.
Gegen die Tradition!
Fehlgeburten müssen in unserer Gesellschaft normalisiert werden. Aus diesem Grund teile ich meine Geschichte so freizügig. Ich finde, es ist absolut notwendig, mit dem Stigma um Fehlgeburten aufzuräumen. Bevor ich die unzähligen Erfahrungsberichte anderer Frauen las und begann, offen mit dem Thema umzugehen, war ich mir keineswegs über die Häufigkeit dieser Verluste bewusst. Dies liegt vor allem daran, dass viele Frauen solch ein Erlebnis mit Scham verbinden, denn sie suchen die Schuld bei sich. Hinzu kommt auch, dass die Tradition, eine Schwangerschaft für die ersten 12 Wochen weitestgehend geheim zu halten, die Isolation der Frau im Falle eines Verlustes noch verstärkt. Das Ergebnis ist, dass diese unzähligen Erfahrungen meist verschwiegen werden. So lange es erst dann salonfähig ist, eine Schwangerschaft anzukündigen, wenn sie in trockenen Tüchern ist, wird das Stigma um Fehlgeburten fortbestehen. Die Frage ist doch, wen dieser Brauch schützt. Ich behaupte nicht, dass jede Schwangerschaft ab dem positiven Test in großen Kreisen gefeiert werden sollte, aber ich möchte zumindest die Intention dieser Tradition hinterfragen. Und ich glaube, der Trend geht in die richtige Richtung. Ganze Social Media Kampagnen, zum Beispiel #ihadamiscarriage, widmen sich mittlerweile diesem Thema. Sie geben Frauen eine Plattform, gerne auch anonym, ihre Erfahrungen zu teilen. Letztendlich können wir die Zahl der Fehlgeburten nicht beeinflussen. Aber ein Füreinander in der Zeit danach macht schon einen gewaltigen Unterschied.
Danke, Felicitas, für deine Geschichte!