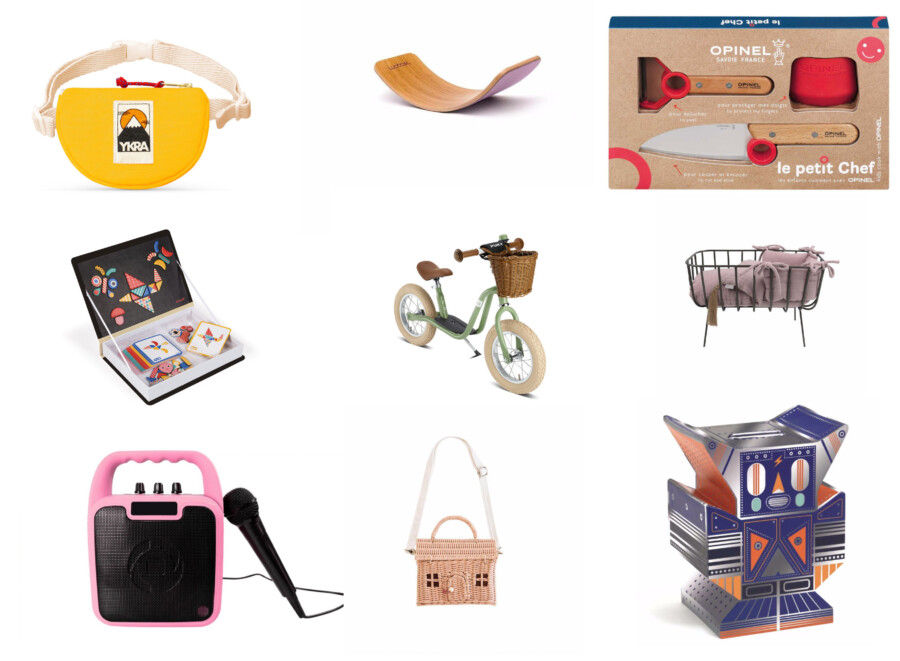Wir freuen uns sehr, dass Fabian Soethof nun regelmäßig für uns schreiben wird! Denn wir finden es unglaublich wichtig, hier auch männlichen Perspektiven Raum zu geben. HIER hat Fabian bereits einen Auszug aus seinem Buch veröffentlicht. HIER könnt ihr noch mehr von ihm lesen. Heute erzählt Fabian, warum er es unglaublich wichtig findet, dass Väter von Anfang “nah dran sind”. Er sagt: “Nur wer schon im Wochenbett versteht, was Eltern im Allgemeinen, aber Frauen im Speziellen schlaucht, kriegt das Rüstzeug dafür an die Hand, auch im weiteren Verlauf der Elternschaft kein abwesender Working Dad zu sein. So anstrengend das auch sein mag.”
Wie Väter verstehen können, was Mütter mehr als sie schlaucht

„Ich muss ausgeschlafen im Büro sein!“
„Es hilft doch niemandem, wenn wir beide müde sind!“
„Das Geld verdient sich nicht von selbst!“
„Beim Stillen kann ich Dir doch eh nicht helfen!“
Es sind Sätze wie diese, die unter frischgebackenen Elternpaaren nicht nur einmal fallen. Meistens spricht der Mann sie aus, und wenn nicht, dann – Achtung, Unterstellung – denkt er sie sich. Warum? Weil schon statistisch gesehen ER es ist, der zwei Wochen nach Geburt des gemeinsamen Kindes wieder im Büro sitzt, als ob nichts gewesen wäre. Weil noch viel zu oft ER der Haupternährer der Familie ist, es gerne wäre oder auf dem Weg dahin ist, es zu werden. Weil SIE ungeachtet ihrer Ausbildung und pränatalen beruflichen Laufbahn durchschnittlich 14,5 Monate Elternzeit nimmt und mit Kind und ohne so genannte “Karriere” zuhause hockt, während rund 75 Prozent aller Väter noch immer gar keine – in Zahlen: 0 Monate – Elternzeit nehmen. Um dann Sätze wie die obigen zu sagen, sich nach Feierabend zu wundern, warum die Wohnung wie ein Schlachtfeld aussieht und wieso um alles in der Welt ihre Frau schon wieder so müde und gereizt ist. Bevor sich mitlesende Männer nun auf den Schlips getreten fühlen: So ähnlich ging es mir und meiner Frau auch.
Bei uns war es auch so!
Auch bei uns dominierte spätestens seit der Geburt unseres zweiten Sohnes ein Dämmerzustand wie im Fegefeuer. Windeln wechseln, Geschrei aushalten, gröbste Stürze vermeiden, dazwischen klägliche Versuche von Erziehung. Vor allem aber: schlaflose Nächte und zombiemäßige Tage. In den Stillmonaten ganz besonders bei meiner Frau.
In den härtesten Phasen des ersten Lebensjahres des Zweitgeborenen sahen unsere Nächte so aus: Bevor wir dutzende andere Schlafkonstellationen ausprobierten, lag ich mit dem damals Dreijährigen im Kinderzimmer, während meine Frau Action im Schlafzimmer hatte: Das Baby schlief nicht ein, dann doch, dann wieder nicht, war unruhig. Und „wir“ so: stillen, stillen, stillen. Schnuller rein, Schnuller raus. Aufstehen. Schunkeln. Leise singen. Hinlegen. Schlafen. Aufwachen. Ich konnte nur selten „helfen“, weil: stillen, stillen, stillen. Schnuller rein, Schnuller raus, Alles von vorne, und so weiter und so fort. Bis irgendwann die Sonne aufging.
Entsprechend fertig und genervt war besonders meine Frau in dieser Phase, entsprechend angespannt die Stimmung. Ich mache zwar dies und das und jenes, aber ich könne ja wenigstens nachts schlafen und „darf“ auf der Arbeit etwas anderes als nur Kinderwahn erleben, so ihr Vorwurf mir gegenüber – der leider auch der Wahrheit entsprach. Ich verstehe sie, behauptete und behaupte ich oft. Aber tat ich das wirklich?
So kam es seinerzeit zur Eskalation: „Pass auf!“, forderte meine Frau mit einer mutmaßlichen Endgültigkeit in ihren Augen, die ich nur wegen unserer Augenringe nicht sehen, dafür spüren konnte: „Ab heute stellst Du Dir den Wecker auf zweistündlichen Alarm. Dann bleibst Du 10-15 Minuten aufrecht sitzen. Um 6 Uhr stehst Du auf und gibst Gas. Das machst Du jetzt mal ’nur‘ zwei Wochen lang. Wenn Du dann immer noch so dreist behauptest, dass Du mich verstanden hast… Machst du es bitte?“ Irgendetwas sagte mir: Das Argument, dass es doch keinem helfe, wenn beide völlig durch sind, bringst du jetzt lieber nicht nochmal. Ich legte los.
Das Experiment…
Es folgten zwei Wochen, die von verrotzten Nächten, Wahnvorstellungen, Delirien, Langeweile und Schlafentzug geprägt waren. Ich stellte mir tatsächlich den Wecker und hörte ihn nur manchmal nicht. Ich hielt mich wach mit Social-Media-Doomscrolling, Chats mit meiner Frau, Immobiliensuchen, Spaziergängen mit und ohne Baby durch die Wohnung, Schunkeleien, Liedersummen, Verabreichung von Fieberzäpfchen, Windeln wechseln und so weiter. Nach der ersten Woche stellte ich fest: Ja, ich bin sehr müde. Wie viel müder als vorher, das wusste ich nicht. Diese Aktion lief nicht wie geplant: Ich stellte mir nicht alle zwei Stunden den Wecker und wurde aus Prinzip wach. Ich wurde wach, weil ich WIRKLICH zu tun hatte. Zu den Highlights zählte, wenn zufällig beide Kinder und auch wir mal zwei bis drei Stunden am Stück schliefen. In der Regel gab ich die Hoffnung darauf aber spätestens morgens um 5 Uhr auf.
Ein kilometerlanges Protokoll dieses Selbstversuchs tippte ich damals, auch um mich wach zu halten, in mein Smartphone und veröffentlichte es später auf meinem Blog. Eine gekürzte Version dieser ultimativen Einschlafhilfe erschien im März 2022 zudem in meinem Buch „Väter können das auch!“.
Angesprochen auf mein Fazit antwortete ich damals wahrheitsgemäß stammelnd meiner Frau, dass der Kleine ja nun krank gewesen sei und ich, nein, wir deshalb eh öfter und länger wach waren. Dass eine Nacht wie etwa die letzte mit längeren Schlafphasen und einem Baby, das sich schnell wieder beruhigen lässt und einschläft, zwischendurch schon mal gut tue. Dass ich grundsätzlich schon sehr müde sei, aber nicht soviel krass müder als vorher, da war ich nachts ja auch wach, ist ja nicht so, als hätte ich vorher gemütlich durchgeschlafen, aber ein bisschen mehr wohl schon, mit ruhigerem und größerem Kleinkind im Kinderzimmer, doch, das mag stimmen.
Sie erinnerte mich daran, dass es ja nicht allein die Nächte seien, die so fertig machten, sondern dazu die Tage, an denen sie keine freie Minute habe, nicht mal kurz mit der U-Bahn ins Büro fahren oder sonst was allein machen könne, nicht mal auf Toilette gehen könne.
ICH war nie so ganz allein…
Ihre „einzige“ Aufgabe: Kind tragen, stillen und bespaßen, und das nach solchen Nächten. Das mache einen zum Zombie, und das erlebte ich in diesem Ausmaß nicht. Auch tagsüber kümmerte ich mich anfangs nie länger allein um das Baby. Weil es wegen des Stillens damals noch nicht ging und weil ich Erwerbs- statt Care-Arbeit nachging. Ich hatte bereits drei Monate Elternzeit und seitdem Teilzeit für sechs weitere Monate, auch beim Erstgeborenen war ich länger zuhause, selbstverständlich. Aber nie so ganz allein – meine Frau war immer da und wir halfen uns gegenseitig. Sie aber hatte tagsüber oft niemanden, der ihr „mal kurz“ das Kind abnehmen konnte, wenn es mal gar nicht mehr ging. So viel zum Thema Gleichberechtigung und dass man sich als Eltern alles teilt. Eine Lüge, denn: Das meiste, so wusste und weiß ich auch von Freund*innen, bleibt (anfangs) doch an der Frau hängen. Ob es nun die Natur so will, die Frau, der Mann, beide oder die Gesellschaft. Es ist so.
Im Nachhinein muss ich feststellen: Ja, ich würde einerseits auch anderen Vätern zu so einem Selbstversuch raten. Wachbleiben aus Prinzip entlastet wirklich niemanden, klar, aber erstens war dann ja doch immer was zu tun, zweitens könnte es schon helfen, das Baby auf Papas Seite schlafen und ihn machen zu lassen, bis Mama wirklich als letzte Instanz ranmuss und drittens macht so ein Solidaritäts-Struggle das Leid der Mutter nachvollziehbarer. Andererseits habe ich aber auch nur die eine Hälfte der anderen Seite der Medaille abgekriegt: Erst, wenn ich nach solchen Nächten auch die Tage über Wochen und Monate hinweg allein mit dem Nachwuchs verbracht hätte, hätte ich endgültiger verstanden, wie anstrengend „klassisches“ Muttersein in der ersten Zeit mit Baby wirklich ist. Spätestens nach dem Abstillen verstand ich es, seitdem komme ich auch tagelang ohne ihre Mama mit den Kindern klar.
Heute finde ich: Je früher ein Vater in puncto Erziehung und Haushalt alles mitmacht, desto selbständiger und unabhängiger kann er als Vater agieren. Je später ein Vater damit beginnt sich einzubringen, desto größer wird das so genannte Gender Care Gap und die Behauptung, die anfangs nur eine Ausrede ist, bewahrheitet sich schleichend doch: Irgendwann weiß Mama wirklich besser, wie „das alles funktioniert“. Sie wurde zwar genauso wenig wie Papa mit einer Bedienungsanleitung zum Kinderkriegen und -haben geboren, aber sie hat sich – wie viel zu viele Frauen da draußen – den Wissens- und Erfahrungsvorsprung selbst erarbeitet.
Nur weil Care-Arbeit nicht bezahlt wird, ist es trotzdem Arbeit. Zumal eine, ohne die niemand, der Kinder hat oder haben will, seiner Erwerbsarbeit überhaupt nachgehen könnte. Nur wer sie mitmacht, merkt, wie hart sie ist. Würde sie bezahlt werden, würden womöglich auch mehr Männer ihren Benefit bemerken und vielleicht zunehmend daran teilhaben. Nun, in Studien wurde bereits herausgefunden: Care-Arbeit zu bezahlen, könnte Deutschland sich nicht leisten. Sie nicht zu bezahlen, aber eigentlich auch nicht.
Dennoch: Nur wer schon im Wochenbett versteht, was Eltern im Allgemeinen, aber Frauen im Speziellen schlaucht, lernt das Rüstzeug dafür, auch im weiteren Verlauf der Elternschaft kein abwesender Working Dad zu sein, der um 19 Uhr aus dem Büro kommt, den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss gibt und sich wundert, warum kein Essen auf dem Tisch steht. Sondern ein anwesender Vater, der seine Frau, seine Kinder und damit seine neue Rolle ernst nimmt. So anstrengend sie auch sein mag.

Fotos: Devon Divine und Hella Wittenberg