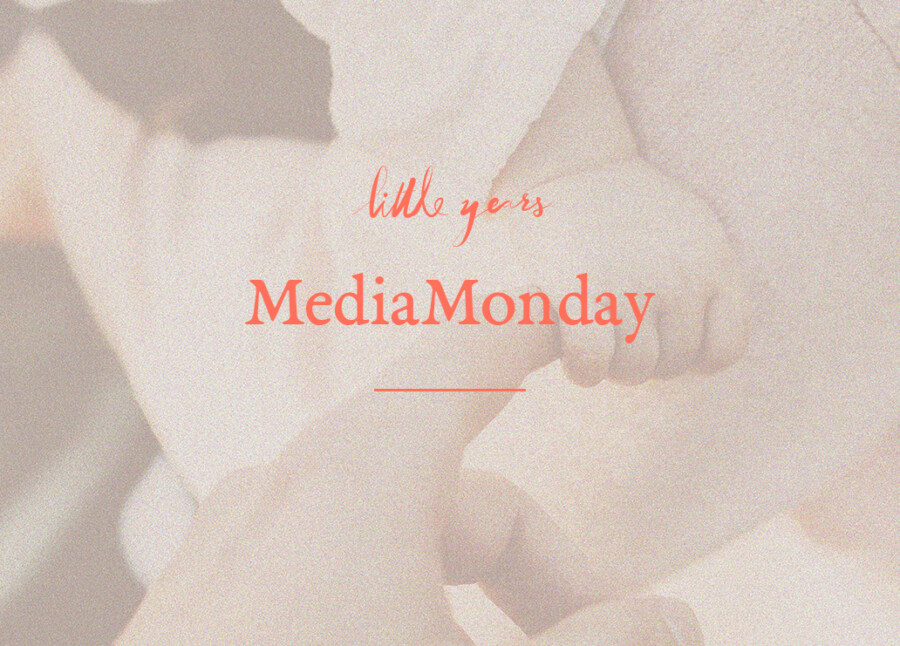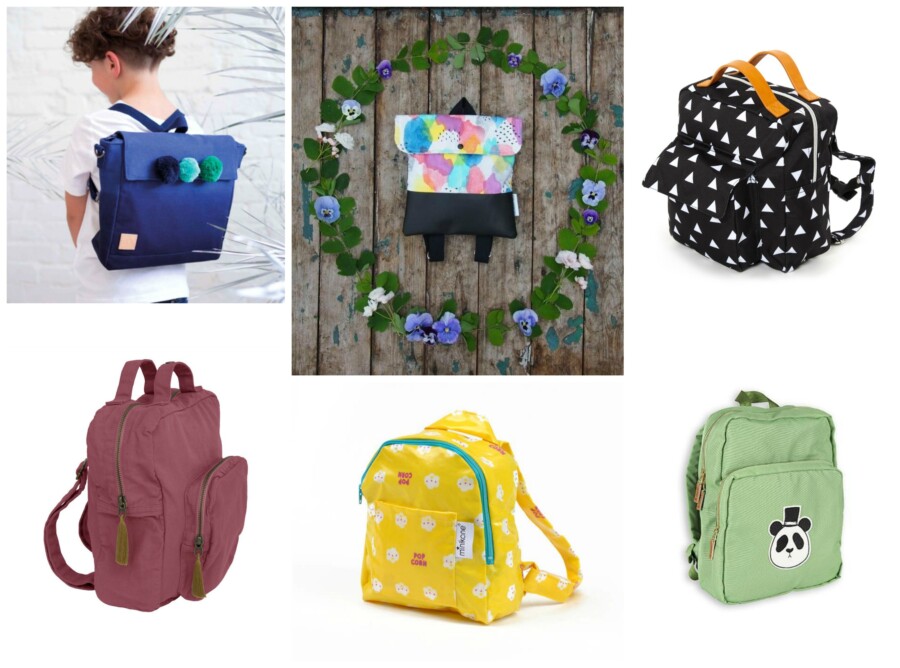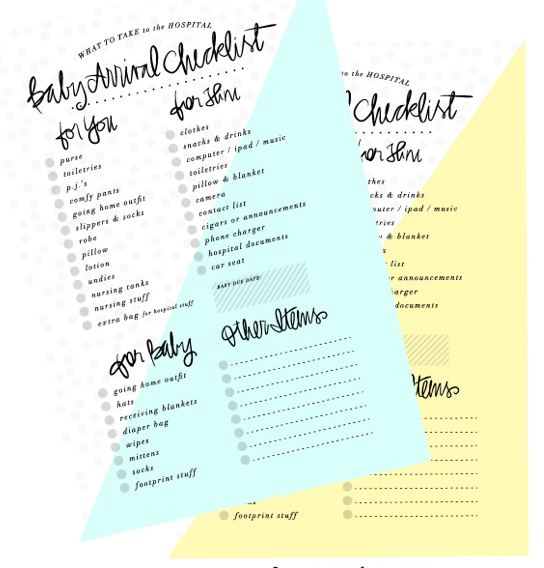Wochenend-Papas sind nicht cool – und Väter, die nicht mal das hinkriegen, peinlich

Auf Instagram und im analogen Leben außerhalb sozialer Medien werden sie oft bejubelt: Wochenendpapas. Selbst- oder fremderklärte Spielplatzhelden, die sich am Samstagmittag ihre Kinder schnappen und mit ihnen zwischen Abenteuerpark, Bolzplatz und Freibad Quality Time verbringen. Bestimmt beziehungsweise hoffentlich, weil sie das wollen. Gewiss aber auch, damit Mama mal drei Stündchen Ruhe hat. „Zeit für sich“, in der sie ständig auf die Uhr guckt, oder, schlimmer, aufräumt, die Wohnung putzt und das Abendessen vorbereitet. Ist doch nett und cool von ihnen? Schließlich würden sie sich eigentlich gerne von ihrer anstrengenden Arbeitswoche erholen und mit den Kumpels ins Stadion? Natürlich sind solche Väter besser als solche, die sich GAR NICHT kümmern. Aber, sorry not sorry: Cool sind diese Kerle deshalb nicht. Sie sind keine Helden. Sie machen damit das Mindeste und das Einfachste. Aufholen und verstehen, was sie als zuhause abwesende Vollzeitarbeitnehmer von Montag bis Freitag im Alltag verpassen, also all die Quantity Time, die meist Mütter investieren und währenddessen noch Druck und bestimmt auch den Wunsch verspüren, mit ihren Kindern ebenfalls Quality Time zu erleben, können sie damit nicht.
Ich kenne Väter und lese viel zu oft von welchen, die schon beim Gedanken daran verzweifeln, dass ihre Frau nicht nur mal zwei Stunden abstinent, sondern ein ganzes Wochenende, geschweige denn eine Woche verreist ist und sie sich in dieser Zeit allein um ihre Kinder kümmern sollen. Und wenn ihre Frauen sich eine solche Auszeit – könnte übrigens ja auch eine Arbeitsreise sein – dann wirklich nehmen, managen die aus der Ferne seine To-Dos mit, weil der so genannte Mental Load schon immer auf ihren Schultern lastete, er drei Kreuze macht, wenn sie wieder da ist und alles danach so wenig gleichberechtigt weiter läuft, wie davor. Don’t get me wrong: Wenn Paare sich bewusst und beidseitig aufrichtig für diese Aufteilung entschieden haben, bitteschön, go for it. Ich behaupte aber, dass viele in die klassische Rollenverteilung reinrutschen. Danke für Nichts, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Patriarchat.
Ich kenne alleinerziehende Mütter, die den Vater ihrer Kinder förmlich dazu überreden müssen, die Kinder auch mal länger als einen Nachmittag zu nehmen und die, wenn er einen Kurzurlaub mit ihnen plant, bis zur letzten Minute bangen müssen, ob die Reise wirklich stattfindet. Und, okay, ich sehe täglich auf dem Schul- und Kindergartenweg (teilweise überraschend entspannte) Mütter, die ihre Kleinen durch den Kiez bugsieren, während ich deren Vater in Monaten oder Jahren noch nie gesehen habe, obwohl ich weiß, dass es ihn gibt. All das mögen Ausnahmen sein. Aber sie zeigen, dass Väter sich viel leichter aus ihrer Rolle sneaken können, als Mütter. Dass sie Applaus für Dinge kriegen, für die Mütter strenge Blicke ernten würden: „Was, sie unternimmt nur am Wochenende mit ihren Kindern etwas? Sie kommt abends erst heim, wenn sie ins Bett gehen, liest dann nur noch etwas vor?“ Merkt Ihr selbst, ne.
Ein Teufelskreis: Die Probleme heißen Gender Care Gap und Gender Pay Gap
Die Schieflage dahinter hat einen Namen. Sie heißt Gender Care Gap. Dazu möchte ich, auch auf die Gefahr hin, hier bei Little Years Eulen nach Athen zu tragen, mindestens für die mitlesenden Männer kurz ausholen: Care-Arbeit ist in der Regel unbezahlte Arbeit in Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege und sozialem Engagement – die mehrheitlich von Frauen übernommen wird. Hier wird strukturelle Benachteiligung messbar. Im Jahr 2019 lag der durchschnittliche Gender Care Gap bei 52,4 Prozent: So viel mehr Zeit als Männer wendeten Frauen täglich für unbezahlte Care-Arbeit auf, schreibt die Datenjournalistin Frauke Suhr unter Berufung auf Zahlen des Familienministeriums: „Bei 34-Jährigen mit Kindern lag der Gender Care Gap sogar noch höher, bei 110,6 Prozent. In diesem Alter ist die zeitliche Belastung von Karriere und zu betreuenden (Klein-)kindern oftmals besonders hoch. Im Schnitt verwenden 34-jährige Frauen mit Kindern täglich 5,18 Stunden für unbezahlte Care-Arbeit. Bei gleichaltrigen Vätern sind es dagegen nur 2,31 Stunden am Tag.“
Und diese Lücke will aus zahlreichen Gründen, über die ich ausführlicher in meinem Buch „Väter können das auch!“ geschrieben habe, partout nicht kleiner werden. Sie wird, nicht zuletzt durch die teilweise Retraditionalisierung von Familien als Folge der Corona-Pandemie, sogar größer. Die Nachricht, dass Väter sich zunehmend um ihre eigenen Kinder kümmern und vermehrt immerhin zwei Monate Elternzeit nehmen, ändert nichts an den Strukturen, die wirklichen Wandel behindern. Politik und Wirtschaft müssen die Gleichstellung der Geschlechter durch verschiedene Anreize, Modelle und Gesetze flächendeckender und aktiver fördern, die Gesellschaft muss gleichzeitig überholte Rollenbilder zurücklassen. Sonst bleiben gelungene Initiativen für mehr Gleichberechtigung Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Eine Idee zur Verkleinerung des Gender Care Gaps und übrigens auch des sich damit wechselseitig beeinflussenden Gender Pay Gaps, also der schlechteren Bezahlung von Frauen, wäre, Care-Arbeit endlich zu bezahlen. Klingt aus konservativer Sicht abwegig, ist es aber keineswegs. Der „Spiegel“ umschrieb ihre wirtschaftliche Notwendigkeit sehr anschaulich: „Sorgearbeit ist ein bisschen wie unverschmutzte Luft oder sauberes Trinkwasser: Firmen und Fabriken brauchen sie, müssen aber nichts dafür bezahlen.“ Unter anderem die Veranstalter*innen des 2016 ins Leben gerufenen „Equal Care Day“ setzen sich deshalb für Bezahlung von Care-Arbeit ein. Sie wissen, dass dies nicht zu einer sogenannten Frauenfalle führen darf, also einem Argument dafür, dass Mütter dank einer Bezahlung ihrer Care-Arbeit ja nun erst recht zu Hause bleiben sollten. Auch Männern sollen und müssen dadurch Anreize zum Überdenken ihre bisherigen Rollenaufteilung geliefert werden.
So weit wird es aber wohl nie kommen können. Wie logisch und gleichzeitig unstemmbar es erscheint, Care-Arbeit zu bezahlen, wird im zitierten „Spiegel“-Artikel nämlich ebenfalls ausgeführt. Wäre Sorgearbeit entlohnt, heißt es darin, würde sie jährlich weltweit dreimal so viel umsetzen wie der IT-Sektor. Das habe die Hilfsorganisation Oxfam in einem Bericht von 2020 errechnet. In Deutschland wird demnach ungefähr ein Drittel mehr unbezahlte als bezahlte Arbeit geleistet, heißt es in einem Bericht des Statistischen Bundesamts von 2016; selbst bei einer vorsichtigen Schätzung würde ihr Wert rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts betragen. Journalistin Lou Zucker schreibt im „Spiegel“ weiter: „Der Gedanke, Hausarbeit und Kindererziehung zu entlohnen, erscheint allein schon aufgrund dieser Zahlen völlig unvorstellbar. Ähnlich unvorstellbar wäre es jedoch, wenn niemand mehr diese Arbeiten verrichten würde. Wir sind also fundamental darauf angewiesen, dass Menschen sie unbezahlt machen. Und diese Menschen sind immer noch überwiegend Frauen.“
Wenn die Bezahlung von einer so grundlegend systemrelevanten Arbeit wie Care-Arbeit also ein wirtschaftliches unlösbares Problem darstellt, sollten wir doch mindestens gemeinsam darauf hinarbeiten, dass diese Arbeit nicht länger auf einem Paar Schultern liegen bleibt – und ihre Umverteilung nicht allein Privatsache sein darf, die mit der Neuaufteilung des Mental Loads geregelt wäre.
Und damit zurück in den elterlichen Alltag: Natürlich ist der nicht ausnahmslos erfüllend, oft im Gegenteil. Brote schmieren, Anziehhilfe, Hinterherräumen, kalten Kaffee trinken, Hausarbeit, Kochen, Putzen, Hausaufgaben, Trösten, Diskutieren, Überzeugen, auch mal Lachen, und zwischen all dem noch die eigene Erwerbsarbeit wuppen, zig weitere To-Dos wie Papierkram, E-Mails, Einkaufen, Arzttermine, Fußballtraining undsoweiterundsofort erledigen – damit nach deren Abarbeitung am buchstäblichen Ende des Tages alles wieder auf Null steht. Dann sind noch keine Urlaube geplant, keine Sätze, geschweige denn Gespräche zu Ende gesprochen, keine Pläne gemacht, die über das nächste Wochenende hinaus gehen, dann ist nur noch Energie für Netflix und Schokolade da. Und am nächsten Tag geht es von vorne los. Ja, das schlaucht – aber das gehört in unserer Gesellschaft wohl oder übel verdammt nochmal dazu. Warum sollte ich mir als Vater also nur die Rosinen rauspicken dürfen? Natürlich ist Erwerbsarbeit auch anstrengend! Aber zumindest solange wir von sogenannten White-Collar-, also Bürojobs reden, behaupte ich: Kein Tag im Büro ist so anstrengend wie einer mit Kindern.
Er ist halt nur bezahlt.
Obacht: Wer all das erkannt hat, ist noch nicht im Elternhimmel angekommen. Ich zum Beispiel kenne nicht nur andere Mütter und Väter, ich kenne auch mich selbst. Erstens habe ich mir selbst oft genug nach Feierabend die Kinder geschnappt im Irrglauben, diese Last-Second-Auszeit würde meiner Frau irgendwie helfen. Zweitens bin ich nach wie vor schmerzfrei. Ich würde mit den Kindern sogar nochmal ins Tropical Island fahren, damit sie einen tollen Tag haben (und am Ende trotzdem meckern werden) und damit – so redete und rede ich es mir oft ein – meine Frau zuhause etwas Ruhe hat. Weil ich ja weiß, dass es für sie wenig Schlimmeres gibt, als etliche Stunden unter einer Touri-Spaßbad-Truman-Show-Glocke zu verbringen, sie unternimmt lieber andere Dinge mit den Kindern. Woran ich dabei nicht denke: Bei unseren Jungs könnte mitunter der Eindruck entstehen, dass ich trotz meiner täglichen Anwesenheit und Care-Arbeit der zu Beginn dieses Textes von mir selbst so verpöhnte Fun Dad bin – und dass Mama langweiliger wäre. Beides stimmt nicht, aber was ich damit sagen will: Die Aufteilung von Freizeit bleibt selbst bei weitgehend gleichberechtigt lebenden und erziehenden Eltern – wir arbeiten beide in Teilzeit – eine Gratwanderung und ein möglicher Konfliktherd. Aber keiner, in dem es um Quantity Time ginge.
Fabian ist Journalist, Online-Redakteur und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin-Kreuzberg. Seit Anfang 2014 betreibt er das Elternblog www.newkidandtheblog.de. Sein erstes Buch „Väter können das auch!“ ist im März 2022 erschienen.