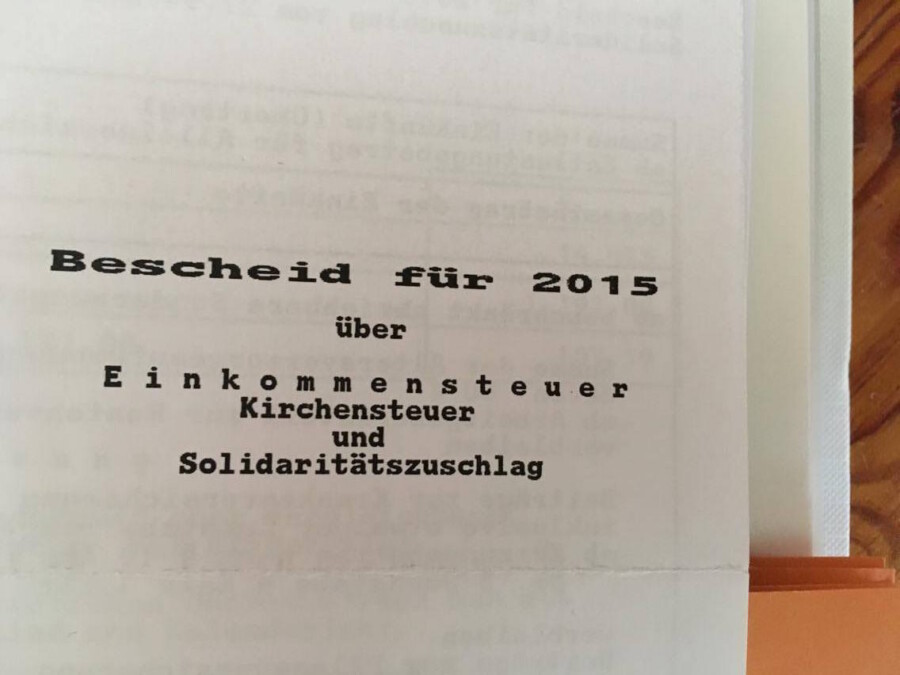Wann krabbelt er endlich?! – warum wir unsere Kinder nicht vergleichen sollten (und es trotzdem zu oft tun)

Denn so souverän, wie ich dachte, das ich bin, bin ich anscheinend nicht. Sogar ÜBERHAUPT nicht! Ich kenne zwar nicht viele Mütter mit Kindern im gleichen Alter wie mein Sohn, aber ein paar dann eben schon. Und als Jascha acht Monate alt wurde, erreichten mich nach und nach immer mehr Nachrichten wie diese: “XXX krabbelt schon.” Oder: “Kann Jascha schon krabbeln?”. Gar nicht böse gemeint, und die Mütter, die mir schrieben, mochte ich auch richtig gerne. Trotzdem war ich irgendwann nur noch genervt. Denn Jascha krabbelte nicht, robbte nicht, und er zog sich auch nicht an irgendwelchen Gegenständen hoch, sondern war hochzufrieden damit, per Drehung seine Wege zurückzulegen (übrigens erschreckend, wie schnell ein Kind auch auf diese Art in die Nähe gefährlicher Mehrfach-Steckerleisten kommt und so eindrucksvoll illustriert, dass die Wohnung noch nicht kindersicher ist…).
Es ist mir fast etwas peinlich, es zuzugeben, aber ich war… neidisch? Ja, doch, ein bisschen. Aber auch, und das viel mehr: Besorgt. War mein Kind spät dran? Das Internet (und der gesunde Menschenverstand) sagten: Nein, gar nicht. Aber der Bauch und das Herz sagten: “Oh mein Gott, mein armer kleiner Sohn, jetzt krabbelt er immer noch nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass er immer so viel schreit und seine ganze Energie dafür draufgeht? Vielleicht hat er bei der Eingewöhnung in der Kita Probleme, wenn er immer noch hauptsächlich rollend unterwegs ist?”. Mein Partner lachte nur und verdrehte die Augen. “Wenn er endlich krabbelt, wirst Du Dich nach der Zeit zurücksehnen, wo man ihn noch relativ unbesorgt auf dem Boden spielen lassen konnte, ohne alle drei Sekunden zu intervenieren”, sagte er. Er hatte wie so oft recht…
Endlich mobil!
Manchmal glaube ich ja, dass Babys ein geheimes Leben haben, in dem sie Dinge schon lange können, aber eben nicht vorführen. Denn zwei Wochen später fing Jascha auf einmal am Abend an, zu robben. Wie aus dem Nichts. Das kriegt mich jedes Mal, war beim Plappern auch so, auf einmal bildet das Kind Silben, als sei ein Update aufgespielt worden, es ist fast etwas unheimlich, weil es gar keine wahrnehmbaren Zwischenschritte gibt. Als er das erste Mal vor sich hin robbte, kreischte und lachte er und machte viele andere merkwürdige Geräusche, ganz offenbar fand er es richtig, richtig cool. Und ich? Schmolz dahin, flippte aus, als hätte er gerade den Nobelpreis gewonnen. Ich glaube, ich habe sogar applaudiert. Nicht auszumalen, wie das wird, wenn er größer ist, vermutlich stehe ich mit einem überdimensionierten Banner im Publikum von Theateraufführungen oder bin beim Mini-Marathon die eine peinliche Mutter, die ihr Kind besonders laut anfeuert.
Wenn ich ehrlich bin, dann lag es auch daran, dass ich doch ein bisschen erleichtert war. Gar nicht, weil ich will, dass Jascha bei allem der Erste, Schnellste, Tollste ist… Das wäre zu einfach. Sondern, weil ich Angst habe, er könnte hinterher hängen. Bei so einem Entwicklungsschritt wie Krabbeln ist das vielleicht lächerlich, aber ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Eine Leserin schrieb mir einmal, dass sie sich manchmal grämt, weil ihr Kind sich noch nicht dreht. Andere Mütter beobachten das Gewicht ihrer Kinder mit Argusaugen, weil es immer an der unteren Grenze der Perzentilkurve verläuft. Und für Mütter, deren Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geboren werden, gelten noch einmal andere Gesetze – doch auch da gibt es sicherlich so etwas wie Missgunst und Standards, an denen man sich misst – oft, ohne es zu wollen.
Können vs. Sein
Vielleicht liegt hier der Hund begraben: Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles gewertet wird, und Erwachsene einer kapitalistischen Logik ausgeliefert sind, in der Leistung und Dazugehören, gutes Aussehen und die Erfüllung anderer Normen immer noch eine riesige Rolle spielen. Wie vermessen ist es also, zu glauben, man sei als Mutter oder Vater darüber erhaben, sein Kind mit anderen zu vergleichen? Es wird immer wieder passieren, dass man ängstlich nach links und rechts schielt und sich fragt: “Ist mein Kind normal?”. Traurig, oder? Gleichzeitig ist es das, was ich eben nicht für mein Kind will: In einer Welt zu leben, in der es ständig bewertet wird. Ich glaube, sich von diesen Wertungen frei zu machen und das Kind einfach sein zu lassen, zuzulassen, dass es manche Dinge nicht oder erst spät oder nie kann, ist ein Ziel, dessen Verfolgung sich lohnt. Auch im Sinne der Inklusion, denn eine Gesellschaft, die den Wert eines Menschen danach bemisst, wie gut er in ihr System passt, was er “leistet” und wie gut er funktioniert ist bei genauem Hinsehen unmenschlich und kalt. Davon wegzukommen ist ein weiter Weg.
Ich weiß, es wird noch oft Situationen geben, in denen ich als Mutter mit meinem Neid und Vergleichsdenken zu kämpfen haben werde und ich hoffe, ich werde es auch hier schaffen, dieses ungesunde Verhalten mit der Zeit abzustellen. Und mein größter Wunsch ist eigentlich, dass es meinem Kind gelingt, sich von diesem Leistungsdenken noch viel weiter zu emanzipieren, sich und andere für das zu lieben, was sie sind, nicht was sie können oder darstellen. Das mag naiv und idealistisch klingen, aber gerade in diesen Krisenzeiten merken wir doch, wie grausam ein auf optimales Funktionieren jedes Einzelnen und unendliches Wirtschaftswachstum ausgerichtetes System ist, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, es regt sich Widerstand und ein Umdenken gegen höher, schneller, weiter, normkonform um jeden Preis.
Für die wirklich schönen und besonderen Dinge gibt es keine Normen, keine Tabellen oder Schemen. Das erste Mal, dass ein Kind sich über eine Katze freut, dieser eine komische Laut, den das Kind macht, wenn es etwas zu essen will, der Tag, an dem man das erste Mal bemerkt, dass die Liegeglatze langsam verschwindet – die Meilensteine, die man selber für sich entdeckt, bedeuten so viel mehr als die vermeintlich wichtigen Maßstäbe, die für alle gelten sollen.
Foto: Minnie Zhou