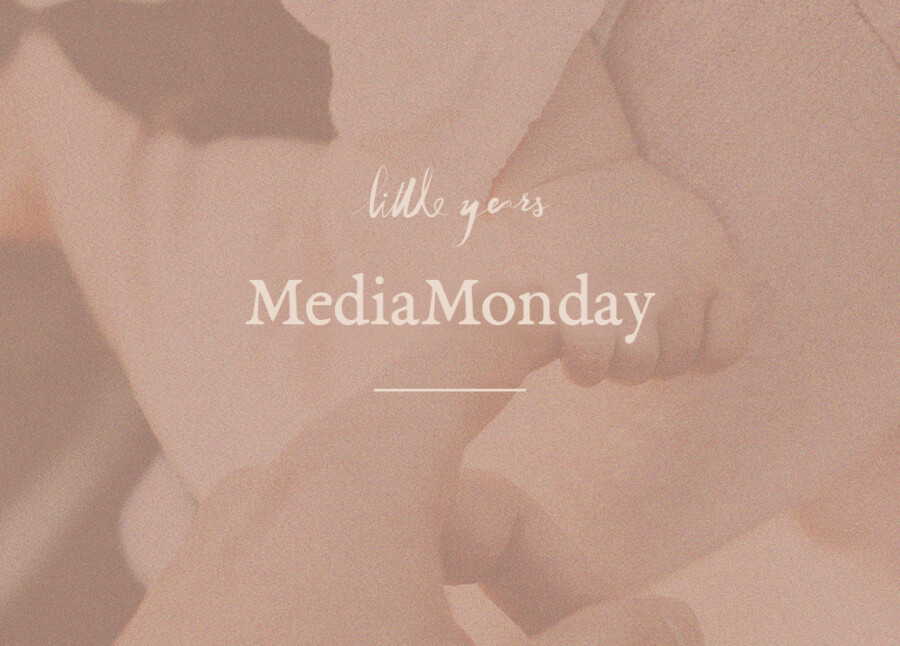“Wir müssen, statt nur zu meckern, mehr in die Handlung gehen” – Mirna Funks neues Buch “Who Cares!”

Liebe Mirna! Dein Buch ist auf der Basis eines heftigen Shitstorms im Mai 2021 entstanden. Und klar, mich hat es auch ab und zu getriggert! Aber am Ende hab ich es versöhnt wieder hingelegt, weil man andere Sichtweisen vielleicht manchmal auch aushalten muss. Aber warum die Provokation? Muss es ungemütlich werden, damit sich etwas ändert?
Ich finde es schwierig, mich als Provokateur abzutun. Das macht es den Leuten einfach, sich nicht auf meine Thesen einzulassen und sich vor allem nicht dem unangenehmen Gefühl, das die Thesen auslösen zu stellen.
Denn: Welche Provokation? Dass ich sage, dass es ohne finanzielle Unabhängigkeit keine Emanzipation gibt? Dass ich sage, wir sind autonom und frei? Dass ich sage, Freiheit ist nicht gleichzusetzen mit Vogelfreiheit, sondern bedeutet im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu handeln?
Vielleicht fühlen sich manche aufgrund des Wahrheitsgehalts so provoziert, nicht weil ich hier manipuliere. Mir liegt Provokation total fern. Das interessiert mich nicht. Ich sage, was ich denke und tue, was ich will. Eine anscheinend völlig irre Eigenschaft hier in diesem Land. Und noch mehr: Es wird ja quasi behauptet, dass genau mein Leben nicht möglich sei. Deswegen scheine ich auch so zu triggern, weil ich der lebende Beweis dafür bin, dass es eben doch geht. Ich habe eine Karriere mit Kind, trotz Patriarchat. Ich vögle, wen ich will, trotz Patriarchat. Ich sage, was ich will, trotz Patriarchat. Ich tue, was ich will, trotz Patriarchat.
Dass Emanzipation ohne finanzielle Unabhängigkeit nicht geht – klar. Mit Provokation meine ich eher andere Dinge, zum Beispiel, dass du schreibst, dass Kinder als Arbeit zu bezeichnen auf Kosten der Kinder ginge. Und ich denke: Klar, Kinder sind wahre Wunder, aber sie sind eben AUCH Arbeit. Das eine schließt das andere ja nicht aus, oder? Das Stichwort Ambiguitätstoleranz kommt ja bei dir auch immer wieder vor…
Wie du oder Carola oder Tina ihr Kind bewerten, ist mir egal. Ich würde im Traum nicht darauf kommen, aus Beziehungen „Arbeit“ zu machen. Die Beziehung zu meinem Kind und alles, was mit diesem Beziehungsleben einhergeht (Windeln, Essen machen, Zahnarztbesuche, Gute Nacht Geschichten), ist eben keine Arbeit für mich. Die Beziehung zu meinen Freundinnen auch nicht. Beziehungen machen Dreck, sind anstrengend, schön, erfüllend, nervig. Sogar die Beziehung zu mir selbst. Aber Arbeit? Nö. Arbeit ist, womit ich mein Geld verdiene. Ich will vom Staat auch kein Geld für meine Freundschaftspflege. Was für eine absurde Vorstellung!
Du widmest dem Thema mehrere Seiten in deinem Buch – vielleicht ist es dann doch nicht egal, wenn Frauen den Begriff Care-Arbeit verwenden oder Erziehungs- bzw. Betreuungsarbeit? Vielleicht gibt es hier aber auch einfach ein Missverständnis, weil der Grundbegriff von Arbeit für dich ein anderer ist als für Soziolog*innen? Fakt ist jedenfalls; „In keinem anderen Land Europas tragen Frauen so wenig zum Familieneinkommen bei wie in Deutschland, zeigte schon 2017 eine OECD-Studie.“, schreibt die Zeit. Woran liegt das, glaubst du?
Ziemlich einfach: Daran, dass Frauen nicht arbeiten gehen. Und zwar insbesondere in Westdeutschland. Das Rollenverständis, das wir heute immer noch sehen, ist das westdeutsche 50er Jahre Modell. Der Mann arbeitet, die Frau kümmert sich um die Kinder. In Ostdeutschland, also da wo ich geboren und aufgewachsen bin, gab es dieses Modell gar nicht. Da haben 91% der Frauen gearbeitet und waren finanziell unabhängig. So gut wie alle Feministinnen, die heute den deutschen Diskurs prägen, kommen aus einem westdeutschen Familienzusammenhang. Deswegen führen sie ja auch immer die sogenannte Care-Arbeit an, um zu behaupten, dass Frauen nicht arbeiten könnten, sobald sie ein Kind haben. In Ländern wie der DDR oder dem heutigen Frankreich ging bzw. geht das aber ohne Probleme. Keine dieser Feministinnen reflektiert ihre eigene Sozialisation, wenn sie von „Vereinbarkeit“ redet. Für mich gab es das Wort „Vereinbarkeit“ nie. Für mich gab es nie die Idee, zuhause zu bleiben. Und zwar, weil ich mit einer arbeitenden Mutter und zwei arbeitenden Großmüttern aufgewachsen bin. Dazu kommt, dass nicht arbeiten zu müssen, ein ökonomisches Privileg ist. Das habe ich nie gehabt. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich froh.
Genau das, das Bild der „Deutschfeministin“ im (westdeutschen) Reihenhaus, die nichts als „die Gendersternchen“ verteilt, aber selber ihr Verhalten nicht ändert, sprichst du oft an. Was können wir vom Osten lernen?
Dass man als Frau arbeitet, eine eigene Karriere anstrebt, wenn man es möchte, sich damit finanziell unabhängig vom Partner macht und vor Ort – im Unternehmen, auf der Arbeit – notwendige Reformen einleitet. Wo ich nicht bin, kann ich nichts verändern. Bis heute gibt es so gut wie keinen Pay Gap im Osten des Landes. Auch der Pension Gap ist viel geringer, weil Frauen dort eben immer gearbeitet haben. Der Pension Gap ist eben kein patriarchales Machtinstrument, sondern das Resultat von Erwerbslosigkeit oder Teilzeitarbeit.
Du schreibst, dass Frauen sich zu gern in ihrer Opferrolle einrichten. Aber kann man nicht auch Opfer (z.B. der strukturellen Umstände) sein und trotzdem Eigenverantwortung über sein Leben haben?
Man kann das System kritisieren, aktiv verändern und Eigenverantwortung übernehmen. Ich als alleinerziehende Mutter bin quasi „Opfer“ des fatalen Steuersystems, das mich – anders als Personen in Ehen- , steuerlich nicht entlastet. Das ist Scheiße. Darüber habe ich schon 2017 einen Essay in Die Zeit geschrieben, darüber spreche ich immer wieder. Aber mich auf den Rücken werfen und jammern ist nicht so mein Style. Dadurch ändert sich nichts. Es braucht eine Steuerreform und diese Steuerreform muss politisch von Individuen durchgesetzt werden. Leider hat niemand aus der aktuellen Bundesregierung das Gefühl gehabt, da mal dran zu schrauben. Das ist aber eine personelle, menschliche und individuelle Entscheidung von Ministern gewesen, dieses Eisen nicht anzufassen. Ich hoffe, dass es vielleicht in den nächsten fünf Jahren angegangen wird. Aber wichtig zu verstehen ist, dass wir niemals in einer perfekten Welt leben werden. Das Heute ist immer besser als das Gestern, aber beschissener als das Morgen. Das ist Menschsein. Wir sind nicht perfekt, also ist es die Welt um uns herum auch nicht. Wir müssen, statt nur zu meckern, mehr in die Handlung gehen. Dann ändern sich auch Dinge.
Als Beweis für deine Thesen, beschreibst du deinen eigenen Lebensweg. Und die Storys sind cool und motivierend – auf jeden Fall. Aber die Menschen sind ja nicht alle gleich. Manche sind stärker, lauter. Manche haben nicht die Kapazitäten, es so zu machen, wie du…?
Ja, genau. So ist das. Gleichheit ist eine Illusion. Die wird man auch nicht staatlich durchgesetzt bekommen. Das sage ich als Bewohnerin eines Landes, in dem der Sozialismus herrschte.
Wir plädieren hier bei Little Years ja oft für 50/50 und geben Tipps, wie eine gleichberechtigte Beziehung besser klappen könnte. Damit der Vater am Start ist, geben wir oft den Rat, einfach mal wegzufahren. Oder ihn halt mal die Nächte machen zu lassen. Gelegentlich kommt dann ein: „Aber die Kinder brauchen mich doch!“ Und wir denken: Manchmal stehen sich Frauen (bzw. ihre Sozialisierung) auch selbst im Weg. Bücher, wie „Die Erfindung der Hausfrau“, in der es auch um den „Mutterliebemythos“ geht, zeigen aber zum Beispiel auf, dass diese Art Sozialisation nicht aus dem Nichts kommt. Wie schaffen es Frauen, aus diesem Denkmuster heraus zu kommen?
Sie müssen verstehen, dass sie einem Mythos und einer Sozialisation anheimgefallen sind. Das wäre der erste Schritt. Der zweite wäre, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Was Kinder brauchen, ist Geborgenheit und Autonomie. Die Eltern und andere Kinder. Nähe und Raum. Auch über den eigenen nationalen Tellerrand zu schauen, hilft. Der Blick nach Frankreich, wo 61% aller Mütter – die durchschnittlich sogar drei Kinder haben und nicht eines wie hier – Vollzeit arbeiten. Aber das sind alles eben Dinge, die kann kein Staat von oben verändern. Wenn du glaubst, ein Kind muss bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr zuhause mit der Mutter bleiben, dann glaubst du das eben, auch wenn es ein mega gutes Betreuungssystem gibt. Diese Vorstellung kannst du nur selber abbauen.
Der Staat kann kein Glück liefern, er ist nicht für unser persönliches Leben verantwortlich – und wir sind nicht seine Kinder. Diese Botschaft lese ich bei dir öfter und ich finde es ziemlich erfrischend, dass jemand das mal so sagt. Trotzdem kann und sollte man sich über Missstände doch beschweren dürfen. Ein Beispiel: Kitaplatzmangel. Du sagst, man könnte doch dann selbst eine Kita gründen. Aber wer hat dafür die Kapazitäten?
Genug Leute. Die gibt es ja. Man muss auch erfinderisch werden. Letztens schrieb mir jemand, pipapo kein Kitaplatz fürs eigene Kind und einem anderen Kollegen ging es ähnlich, was nun? Noch drei weitere Kinder finden, eine arbeitslose Erzieherin suchen und die Kinder in einer Wohnung betreuen und sich das Honorar teilen. Als ich der Person das schrieb, ging ihr ein Licht auf. Ja, stimmt. Man kann ja einfach Out-of-the-Box machen. Ja, genau! Kann man.
Nochmal, wer es sich leisten kann, nicht flexibel sein zu müssen, der hat eigentlich gar kein Problem. Druck ist nicht einfach nur schlecht, sondern bewirkt meistens Wunder. Daraus entstehen die besten Innovationen. Freiheit gibt es nicht umsonst und auch nicht ohne Widerstände. Wer das glaubt, hat Freiheit nicht verstanden.
Danke dir, Mirna!

“Who Cares! Von der Freiheit, Frau zu sein” von Mirna Funk erschien im dtv-Verlag.
Titelbild: Marcus Witte