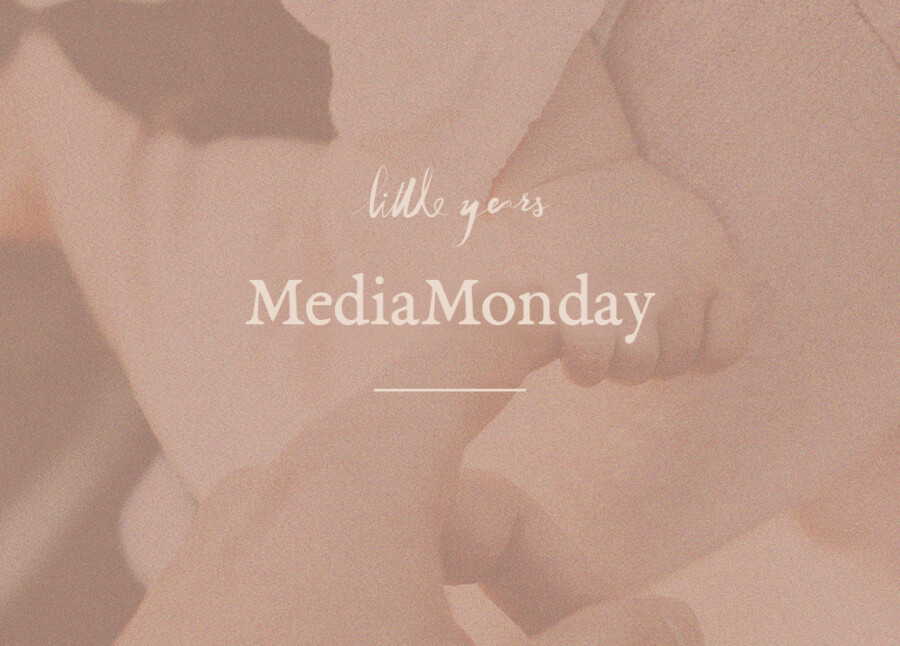Let’s talk about: Wie wir arbeiten wollen

Es ist gewisser Weise unser aller Potenzial in diesen Tagen, die so sehr bestimmt sind von dem, was wir Digitalisierung nennen und sich anschickt, uns von den überholten Paradigmen zu erlösen, die wir zuweilen in einer fixen Assoziationskette zum Thema Arbeit abspulen. Der Leistungsfetisch etwa als Selbstverständlichkeit, um mal ein Stichwort zu bemühen. Die Digitalisierung scheint wiederum die Chance zu sein, in so einer Art „Reset“, die Bedingungen neu zu formulieren, zu denen wir arbeiten und letztlich die Arbeit an unser Leben anzupassen anstatt unser Leben dem Arbeiten zu unterwerfen. Was das wiederum mit uns Eltern zu tun hat, werden wir im Folgenden noch sehen. Gedanken zu diesem Thema formuliert haben Isabel und Marie unterdessen bereits hier, hier, hier oder auch hier in einem Working-Mum-Portrait.
Die Arbeitsbedingungen jedenfalls, wie sie in den allermeisten Büros wohl noch den Alltag bestimmen, scheinen mir demgegenüber sehr antiquiert: „9-to-5“-Jobs, Anwesenheitspflicht, künstliches Licht. Als seien uns unsere Büros nicht weniger Kerker als den Fließbandarbeitern damals die Fabrik. Mit dem Unterschied, dass der geregelte 8-Stunden-Arbeitstag, wie er innerhalb der Industriellen Revolution einmal etabliert wurde, ursprünglich einen Fortschritt bedeutete, die Lebensverhältnisse der Arbeitenden wesentlich verbesserte.
Die Dampfmaschine dieser Tage ist das Internet
Schauen wir einmal in die Geschichte zurück und auf die Industrielle Revolution als Denkanstoß, welche Chancen, aber auch Risiken derlei Umbrüche bergen: Im London des 19. Jahrhunderts betäubte sich eine ganze Stadtbevölkerung mit Gin. Der war günstig. Arbeit gab es hingegen wenig, die Armut war dementsprechend groß. Dann kam die Industrialisierung und mit ihr die besseren Lebensumstände. Die Menschen begannen in Arbeit und Feierabend zu denken und tranken nun keinen Gin mehr, schauten – und hier gilt es den Zeitraffer als Stilmittel zu verstehen – stattdessen Fernsehen.
Facebook, Youtube & Co. als riesige Datenkraken, die unsere Freizeit skalieren, unseren Feierabend monetisieren.
Mit dem Siegeszug der modernen Kommunikationstechnologien wandelte sich die passive Abendgestaltung vor der Glotze schließlich zum aktiven Konsum, veranlasste den einen oder anderen gar zur Hobby-Produktion. Es sollte wiederum nicht lange dauern, bis die Wirtschaft diese Form der Internetnutzung als Teil einer Wertschöpfungskette erkannte und Crowdsourcing-Plattformen entwickelte, um das Potenzial der jeweiligen User zu bündeln. Et voilá: Facebook, Youtube & Co. waren geboren und damit riesige Datenkraken, die unsere Freizeit skalieren, unseren Feierabend monetisieren.
Nun stehen wir also an den Pforten der Digitalisierung. Wobei: Nein, eigentlich ist sie längst da, wir bezeugen sie gewisser Weise als Chronisten – dieses Business mit unseren Daten und den Maschinen, die daraus in Algorithmen lernen, sich selbst zu unterrichten. Wenn man Ökonomen Glauben schenken will, sind mit der Automatisierung eine ganze Reihe, wenn nicht gar die allermeisten Jobs gefährdet, die lange Zeit als super sicher galten. Sprich: wir leben in der Schwebe und es wird Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir den Kuchen aufteilen wollen, der uns da gerade präsentiert wird, ehe sich irgendjemand anderes am Großteil seiner schmackhaften Stücke vergeht und uns nur ein paar Krümel überlässt.
Die Elternschaft als Sinnkrise und ökonomischer Neustart
Offenbar scheinen jedenfalls diese zwei Szenerien – Elternschaft und Automatisierung – ganz wunderbar zusammen zu passen. Beide Umbrüche bergen nämlich das Potenzial, das Arbeiten wie es war, grundlegend neu anzugehen, weil es schlicht gar nicht mehr so zu handhaben ist, wie es einmal war. Die Digitalisierung wie die Elternschaft auch als Krise des Systems, aus dem die Zukunft als Erkenntnis aus dem Systemsturz ergeht.
Es mag sicher Eltern geben, die einfach einen Haufen Kohle für Babysitter auf den Tisch legen, um ja nicht den Weg als Manager durch die sogenannte „gläserne Decke“ zu gefährden – á la Sheryl Sandberg. Ich will das auch gar nicht bewerten, glaube aber wiewohl, dass es so was von Zeit ist, damit zu brechen, wie Karriere, Erfolg, inzwischen wohl Arbeiten per se angelegt ist: Nämlich schwitzend, immer im Einsatz, Zeit als entscheidendes Parameter. Vor allem viel, viel Zeit opfernd. Letztlich das ganze Leben vereinnahmend.
Und das, obwohl nun schon einigen Jahren besprochen wird, wie sehr sich die Generation Y anschickt, an diesen Festen zu rütteln. So schreibt Ulrich Schnabel, seines Zeichen Wissenschaftsredakteur der ZEIT und Autor des Buchs „Muße. Vom Glück des Nichtstuns“ in einem aktuellen Artikel für die Konrad-Adenauer-Stiftung etwa: „Während es früher als Kennzeichen der viel gefragten Erfolgreichen galt, ständig erreichbar und allzeit online zu sein, zeigt sich das neue Prestige darin, […] über die eigene Zeit selbst verfügen zu können.“
Die Realität der allermeisten Arbeitenden ist wohl immer noch eine andere. Wieder einmal so ein Bubble-Phänomen, wie es sie dieser Tage ja überbordend viele zu geben scheint, versucht man etwa die Krise des Journalismus’ zu verstehen.
Feierabend 4.0 als Notwendigkeit, zu funktionieren
Jedenfalls wird dahingehend immer wieder bemüht, es bedürfe auch besserer Betreuungsmodelle für die Kleinsten, um Frauen als Humankapital (allein dieser Begriff!) besser in die Wertschöpfungskette einzuflechten. Und klar, Kita ist wichtig. Aber noch viel wichtiger scheint mir zu erkennen, was uns die Digitalisierung noch einmal unter die Nase reibt, aber eigentlich schon immer gilt: dass nämlich Erfolg nicht nur davon abhängt, wer am allermeisten Stunden reißt und am fleißigsten ist, sondern vor allem dadurch bestimmt ist, wer seine Zeit effektiv einzusetzen weiß, also schlau arbeitet und im Ideal dabei richtig viel Zeit zum Ausspannen, zum Nichtstun herausschlägt.
Denn „die ‚Muße im Kopf’ ist […] kein Luxus für arbeitsscheue Faulenzer, sondern im Gegenteil eine Notwendigkeit, die in unserer schnelllebigen, geistig so herausfordernden Zeit immer wichtiger wird“, schreibt Ulrich Schnabel im oben angeführten Artikel weiter. Wer auf Dauer in der Online-Welt mithalten will, müsse die Kunst beherrschen, auch gezielt offline zu gehen. Ich würde ja sogar behaupten, dass es nicht nur dieser kurzen Ruhepole bedarf. Dass Meditation, Yoga oder das Spa am Wochenende sicher kein Allheilmittel ist gegen grundsätzlich überlastete Systeme – sprich: dem dieser Tage arbeitenden Menschen.
Die Mompreneurin als Antwort auf das Narrativ „Arbeiten mit Kind“
Und da wären wir bei den Eltern und gewisser Weise auch bei einem Teil der Lösung des Arbeits-Dilemmas: Eltern sind wohl recht häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, sie wüssten nicht so viel Zeit wie die kinderlosen Kollegen auf den Job zu verwenden. Gleichsam ist es sicher nicht nur eine gefühlte Wahrheit, dass man mit Kindern beginnt, effektiver zu arbeiten, dass wir Eltern unsere knappen Zeitressourcen besser einzusetzen wissen – wie Isabel hier auch schon einmal berichtet hat.
Nun wird die Frage darauf, wie wir denn abseits der Automatisierung überhaupt noch arbeiten können, also wenn Maschinen unsere Jobs erfüllen, nicht damit beantwortet, dass gewinnt, wer am schnellsten alle Aufgaben abarbeitet. Es sind wahrscheinlich vor allem jene Personen, die als Gewinner aus dieser Revolution hervorgehen werden, die flexibel genug sind, sich an die neuen Umstände anzupassen, ihr Berufsbild zu überdenken und es den Ansprüchen der Zukunft gemäß zu formulieren.
Und schon wieder: Eltern als ideale Zielgruppe. Denn wenn wir Eltern uns auf etwas verstehen, dann uns an radikale Umbrüche zu gewöhnen. Kein Wunder also, dass es dieser Tage so viele Frauen gibt, die sich als Mompreneure versuchen. Die, nachdem sie vor dem Kind festangestellt waren, mit dem Baby und aus der Not, das alte Leben nicht auf das neue überstülpen zu können oder zu wollen, ihren eigenen Weg gehen. Es relativiert sich ja oft auch so viel mit Kind: die fremdbestimmte Arbeit verliert an Bedeutung, das Leben darüber hinaus rückt in den Vordergrund.
„Work is not a job – Was Arbeit ist, entscheidest Du!”
Dahingehend finde ich Catherina Bruns übrigens sehr spannend. Wiewohl sie ihren Weg als Entrepreneurin wohl unabhängig von der Kinderfrage gegangen ist. Bruns arbeitete nach eigener Auskunft eine Zeit lang im Online-Marketing eines großen Unternehmens, ehe sie – wie sie sagt (und ihr euch unten im Video selbst ansehen könnt) – darüber krank wurde und sich in die Selbstständigkeit aufmachte. Sie schreibt Bücher, die Titel tragen wie „work is not a job – Was Arbeit ist, entscheidest Du!“ und versteht sich selbst als große Verfechterin der Selbstständigkeit. Und wir reden hier nicht von Freelancern, die schlecht bezahlt vor sich hin krebsen. Bruns will vielmehr dazu ermutigen, sich selbstbehaupteter zu verstehen, seine Arbeit dementsprechend nicht unter Wert zu verkaufen. Das kann mit einem eigenen Unternehmen funktionieren – Bruns hat zum Beispiel die Plattform supercraft mit auf den Weg gebracht – aber auch innerhalb einer Festanstellung, wenn wir die nach unseren Kriterien anlegen.
So eine Festanstellung ist Heute ja nicht mehr in Stein gemeißelt und auf ein ganzes Leben angelegt. Wenn uns Unternehmen befristete Arbeitsverträge vorlegen, sollte uns das immer auch daran erinnern, dass die Firma uns nicht nur etwas gibt, wir vielmehr auch von ihr fordern können und sei es, dass wir die Konditionen maßgeblich mitbestimmen. Teilzeit. Bezahlung. Wo wir arbeiten. Zum Beispiel in Remote von wo immer es uns passt: vom Homeoffice aus, im Café, mit dem Baby auf dem Schoß, in einem anderen Land – so wie Isabel bald von Südafrika aus arbeitet.
Wer jetzt denkt: Das mag für die da drüben in dieser Berliner Blubberblase funktionieren, aber MEIN Chef geht das niemals mit. Doch: würde er. Wenn wir als Arbeitskraft nicht ersetzbar sind. Dahingehend kann man sich schön an jenen Fachkräften orientieren, nach denen der Markt gerade schreit. UX-Designer zum Beispiel oder Web-Developer. Im Abgleich zu dem, was der gewöhnliche Arbeitnehmer so erfährt, werden diese Berufsgruppen gerade regelrecht hofiert, gar wie Kaiser behandelt. Utopisch hohe Tagessätze, die da bezahlt werden oder die Option, ortsunabhängig zu arbeiten. Ich bin jedes Mal wieder sprachlos, wenn mir Bekannte davon erzählen.
Sich die Transaktionskostentheorie zu Nutzen machen
Was gilt es also zu tun: Sich unabdingbar machen. Nicht ersetzbar sein. Sich nicht ständig in Frage stellen. Sich auf die Fragen der Zukunft einlassen und sein Profil danach ausrichten. Was wiederum vor allem bedeutet und eigentlich so naheliegend ist: Die eigenen Kompetenzen zu erkennen und selbstbewusst auszuspielen, anstatt sich zu verbiegen. Aber auch zu hinterfragen: Was mache ich selbst, was gebe ich ab? Make or pay? Eine ganz simple Weisheit der BWL, auch Transaktionskostentheorie genannt. Dirk Nowitzki etwa würde niemals seinen Rasen mähen (es sei denn vielleicht als meditativen Ausgleich). Er würde natürlich jemanden einstellen, der ihm das abnimmt, weil er in derselben Zeit viel, viel mehr Geld verdienen kann, mit etwas, in dem er richtig gut ist: Basketball spielen.
In meinem Fall würde der Ansatz so funktionieren: Ich war nie gut darin, am Fließband Texte zu produzieren, deren Mehrwert ich nicht erkennen konnte. Immer, wenn sich bei mir der Verdacht einschlich, dass es sich wahrscheinlich ohnehin nur um Bullshit-Themen handelte, die für niemanden von Nutzen seien, ging ich innerlich auf die Barrikaden.
Gut war ich stattdessen immer darin, Dinge aufzuschreiben, die mir bedeutend schienen und bei denen man mir überließ, sie als Themen frei zu gestalten. Ergo arbeite ich dieser Tage nicht mehr als festangestellte Redakteurin, stattdessen fest frei für Auftraggeber. Das funktioniert ganz wunderbar und ist alles andere als prekär. Es ist vielleicht hier und da riskanter als fest angestellt zu sein. Wobei: Sicherheit scheint mir ohnehin so ein albernes Konzept. Was ist letztlich schon gänzlich versicherbar? Als freie Autorin habe ich – und das ist für mich letztlich entscheidendes Kriterium gewesen – die Freiheit, mich so um Julius zu kümmern, wie ich es für angemessen halte und trotzdem von meiner Arbeit leben zu können – ja, sogar richtig gerne zu tun, wofür ich bezahlt werde.
Das Ende der sinnentleerten Arbeit
Das jedenfalls, was Karl Marx in „Das Kapital“ gefordert hat, steht mit der Automatisierung vieler Prozesse scheinbar unmittelbar bevor: den Menschen von sinnentleerter Arbeit zu befreien. Ja, die Befreiung gewisser Weise als Selbstzweck: „Wenn nur die Arbeit Wert produziert,“, wie er auch schrieb, „aber der Anteil der Arbeit immer weiter zurückgeht gegenüber der Macht der Maschinen, dann entsteht immer weniger Mehrwert.“
Ich denke insofern auch gerne an Frank Schirrmacher zurück, der als einer der F.A.Z.-Herausgeber seinerzeit sicher streitbar, aber auch visionär war, wenn er formulierte, dass es vor allem einer digitalen Mündigkeit bedürfe, um der organisierten Verantwortungslosigkeit entgegen zu treten. Und wie viel besser könnte es denn sein, als das sinnentleerte Arbeiten hinter uns zu lassen und uns stattdessen im Privaten wie im Geschäftlichen wieder auf wesentliches zu besinnen. Abseits der Gier, dem Status und damit einer Arbeit, die vor allem narzisstischen Motiven dient.