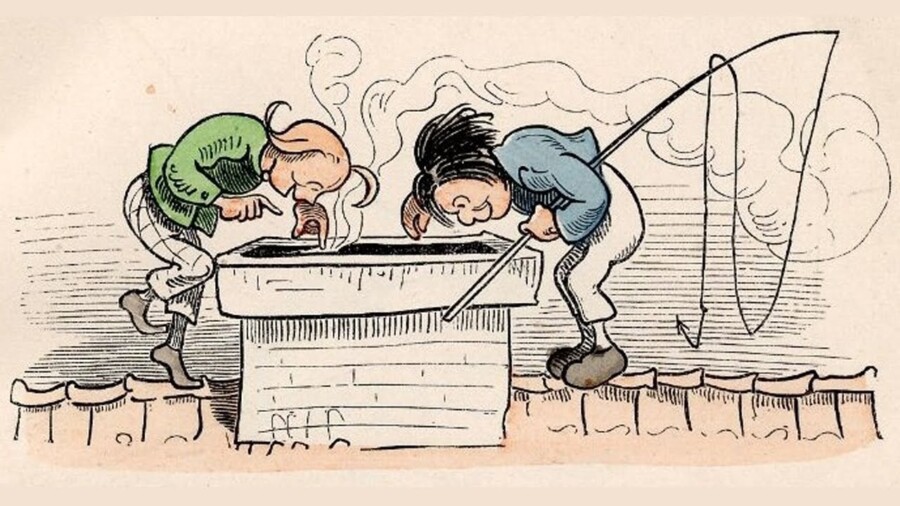Warum Muttersein nichts mit Selbstaufgabe zutun hat – im Gegenteil!

Ich wusste schon immer, dass ich Kinder haben möchte. Auch einen erfüllenden Job, einen tollen Mann und enge Freunde. Aber Kinder gehörten immer zum Paket dazu. Ganz wie Caroline Rosales vor Kurzem über so manche Alleinerziehende schrieb: “Kinder: ja, bitte! Die Liebe: wenn es passt.” Kinder zu haben ist also doch in vielen Fällen unserer Generation eine selbstbestimmte Entscheidung. Und deshalb so gar nicht aufopfernd, sondern fast schon egoistisch. Es ist die Verwirklichung einer Lebensvorstellung und damit ein bestärkender Faktor. Auch wenn der Mann dazu eben nicht da ist. Alles eine Modeerscheinung? Mitnichten, glaube ich.
Trotzdem hat ein geschätzter Großteil der heutigen Alleinerziehenden wohl etwas anderes vorgehabt. Wahrscheinlich haben sich unter Tränen durch eine Trennung gekämpft. Das möchte ich auch gar nicht schön reden. Auch das manche Alleinerziehende durch das gesellschaftliche Netz fallen und am Rande ihrer Existenz zu kämpfen haben. Das soll auch kein “Ihr lebt prekär, aber hey, wenigstens selbstbestimmt”- Hochgesang sein. Denn wie viel Mündigkeit gibt es denn noch, wenn man nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann? Aber trotzdem will ich behaupten, dass Muttersein keine Selbstaufgabe bedeutet. Sondern einfach ein Teil unseres (erfüllten) Lebens ist. Trotzdem frage ich mich, wie es eigentlich kam, dass viele Kinder als Lebenslast- und Spaßbremse sehen? Hat das was mit der “Du-kannst-alles-erreichen-hab-nur-bloß-keine-Kinder-zu-früh”-Geschichten zutun, die ich von meinen Eltern gehört habe? Denn wenn du erstmal Kinder hast, dann musst du dich aufopfern, schien das zu sein, was sie sagen wollten.
Die Aufopferungsfabel unterdrückt Frauen
Ich kenne die Geschichten aus den Märchenbüchern nur allzu gut; die aufopferungsbereite Mutter, die alles für ihre Kinder tut und natürlich gar keinen anderen Sinn in ihrem Leben sieht, als eben Mutter zu sein. Diese Geschichten haben einen Erwartungsdruck aufgebaut und auch die ständig lauernde Sorge in mir, ich tue nicht genug fürs Kind, denn ich lebe ja selbst immer noch und spüre mich – komischerweise fühle ich mich gar nicht selbstlos. Dass Muttersein mit Selbstaufgabe zutun hat, entwertet uns als Person, denn laut dieser Annahme existieren wir ja nur noch für jemand anderen. Auch wenn, oder gerade weil, es so etwas “Heiliges” ist, wie Kindergroßziehen – wir haben damit keine eigene Identität mehr, sondern sind nur noch die der aufopfernden Mutter. Genauso wie man das Muttersein als einen Job bezeichnet, wir tun wir uns einfach keinen Gefallen damit: “Calling motherhood a woman’s “job” only serves to keep a woman in her place.” schreibt die New York Times ganz zu Recht.
Und ich will sogar einen Schritt weitergehen:
Niemand ist nur für jemanden da! Ich glaube nicht an Altruismus. Ich glaube, dass es auch ganz viel um einen selbst geht, wenn man etwas für andere tut: Das bessere Gefühl, das man hat. Das gute Gewissen. Die Selbstbestätigung: Ich kann etwas tun! Ähnlich ist es mit dem Kinderhaben: Nichts macht mit glücklicher, befriedigter meinen Sohn freudestrahlend über eine Wiese laufen zu sehen. Und dabei irgendwie auch zu wissen, dass sein Glück zu einem großen Teil mit mir zutun hat. Und noch ehrlicher: Für mich ist der Gedanke wunderschön, dass ich auch nach meinem Tod weiterexistiere. Dass der Sohn vielleicht auch mal Kinder bekommt. Das wir Teil des großen Ganzen sind.
Nur wenn wir aufhören über das Muttersein als ein Opfer zu sprechen, können wir die Anerkennung bekommen, die uns zusteht.
Titelbild: Aus unserem Porträt mit Celia Muñoz. Fotografiert von Sarah Winborn.