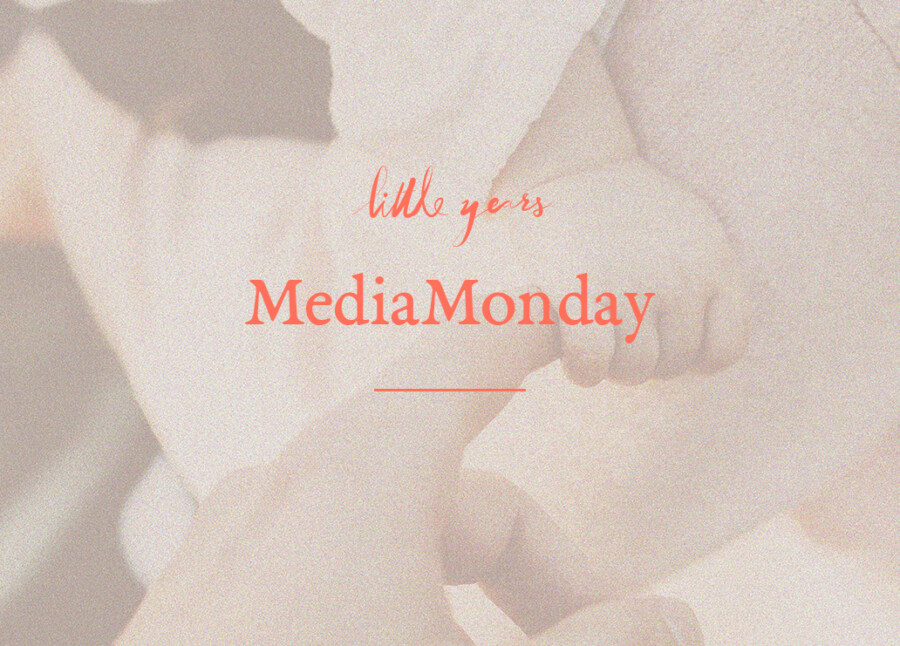Warum Stillen nicht gleich Liebe ist (und es trotzdem toll ist, wenn es klappt)

Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber: Stillen lief bei mir richtig gut. Gleich, ohne große Vorbereitung oder Mühe, einfach so. Ich weiß noch, wie amüsiert meine Gynäkologin bei der ersten Untersuchung nach der Geburt meines Sohnes schaute, als ich sagte: “Das Stillen klappt sogar wirklich gut”, und mich fragte: “Wieso sollte es das nicht?”. Offenbar lebte sie auf einem anderem Planeten als ich.
Denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Stillen problemlos klappen würde. In dem reichlich esoterischen Geburtsvorbereitungskurs, in dem ich war (ein Thema für sich), legte uns die Hebamme sogar nahe, schon Wochen vor der Geburt Colostrum auszustreichen und einzufrieren, für den Fall, dass es mit dem Anlegen nach der Geburt nicht gleich klappt. Damit wir gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, auch nur an ein Fläschchen zu denken. Es klang fast so, als wäre Fläschchen geben gleichzusetzen mit Vernachlässigung des Kindes.
Zwei meiner engsten Freundinnen erzählten von blutigen Brustwarzen und Stillberatungen, die auch nichts gebracht hatten, eine Bekannte nannte das Stillen “eine Wissenschaft für sich”. Und dazu kam, dass meine Mutter mich ebenfalls nicht gestillt hatte – sie war nach dem Kaiserschnitt sehr schwach gewesen, ich hatte Neugeborenen-Gelbsucht und wurde bestrahlt. Also keine super Voraussetzungen.
Ja und trotzdem hat es bei mir dann gleich gut geklappt.
Stillen ist vor allem: Problematisch
Dass das Stillen jede Mutter umtreibt, egal, wie es damit bei ihr läuft, seht ihr auch bei uns auf dem Blog: Marie hat hier über Stillmythen geschrieben, Isabel hat sich nach heftigen Stillproblemen auch schon mal gefragt, ob Stillen wirklich immer das Beste ist, hier ging es um Stillen und Feminismus und hier darum, wie lange man eigentlich stillen möchte.
Es scheint manchmal, als könnten viele gar nicht anders, als diese biologische, aber eben auch banale Sache, entweder zu überhöhen, zu verteufeln, und immer irgendwie zu instrumentalisieren. Kaum eine andere Körperfunktion ist so behaftet mit Zuschreibungen. Hinter dem ganzen Spektrum an Stillkonventionen verbirgt sich oft der geballte Druck, der auf Mütter ausgeübt wird. Weil ihnen immer von irgendwem vermittelt wird, was für eine Mutter sie sind, weil es kaum eine Rolle im Leben einer Frau gibt, die ähnlich vielen Urteilen und Bewertungen unterliegt. Als drücke sich Mutterschaft auch darin aus, wie wir unser Kind versorgen, mit dem Fläschchen oder der Brust. Was totaler Schwachsinn ist. Was aber auch gefährlich und traurig ist, denn das Private ist Politisch, und diese dogmatischen Ansichten rund ums Stillen propagieren vor allem ein unglaublich patriarchales Bild von Frauen und Mutterschaft.
Nun hatte ich, wie gesagt, trotz Kaiserschnittgeburt und der Erwartung, das Stillen werde sicherlich ganz schrecklich anlaufen, das Glück, dass es bei mir und meinem Sohn einfach lief, haha. Wobei: Es lief auch deswegen, weil mir eine Krankenschwester in der zweiten Nacht nach der Geburt ein Stillhütchen gab. Und meine Hebamme mich auch darin unterstütze, es weiter zu nutzen. “Irgendwann hast Du es nicht dabei und dann klappt es ganz von alleine ohne”, sagte sie. Und tatsächlich probierte ich, als Jascha schon fast drei Monate alt war, vor einer Zugfahrt mal, ohne das Hütchen zu stillen, und es ging. Ich hätte mich auch hier verrückt machen können – gebt mal Stillhütchen bei Google ein, die sind durchaus kontrovers– aber ich habe mich einfach geweigert, da nach Perfektion zu streben. Das Kind trank, dann eben mit Hütchen.
Innigkeit ja, Liebe nein
Nachdem die Geburt keine Bilderbuchgeburt war, er viel weinte und kaum schlief, war ich einfach froh, dass zumindest eine Sache bei uns so gar nicht problematisch war. Und ja, beim Stillen gab es natürlich innige Momente mit meinem Sohn, aber es war auch manchmal ziemlich anstrengend, Nahrungsquelle eines Menschen zu sein. Das wird in diesen romantisierten Darstellungen von stillenden Müttern ja auch gerne mal übersehen: Dass da ein kleines Wesen mitunter über drei Stunden kaum von der Brust wegzubekommen ist (Stichwort: Clusterfeeding), ist vor allem: Ermüdend. Die Abende, die ich so verbrachte, bis mir die Beine einschliefen und ich super dringend auf die Toilette musste, liegen in der Vergangenheit und das ist auch gut so.
Die Innigkeit, die ich beim Stillen mit meinem Sohn gespürt habe, war tatsächlich etwas, das ich so nicht kannte und an das ich gerne zurückdenke. Aber: Ich glaube, diese Innigkeit kann man auch mit Fläschchen haben. Oder beim Baden, Wickeln, Kuscheln, Spielen. Ja, natürlich ist das nicht dieses Steinzeitding, aber seit wann überhöhen wir eigentlich menschliche Fähigkeiten aus der Steinzeit? Ist doch in anderen Bereichen auch nicht so. Stillen ist toll, wenn es klappt, es ist praktisch, gratis, gesund, weniger umständlich als Milchpulver anrühren.
Aber wenn es nicht klappt, dann heißt das einfach nur: Das Stillen hat nicht so gut geklappt. Und es heißt nicht: Du bist eine schlechte Mutter/ Dein Kind kriegt nicht genug Nährstoffe / Du hast versagt. Und im Subtext schwingt mir das noch viel zu oft mit. Vor allen Dingen aber finde ich es schade, dass viele Frauen, so wie ich auch, so besorgt an dieses Thema herangehen, anstatt es einfach entspannt auszuprobieren, sich vielleicht sogar darauf zu freuen. Und umgekehrt nicht am Boden zerstört zu sein, wenn es nicht funktioniert. Warum auch immer. Und was mit diesem Druck, das Kind zu stillen, nebenbei auch gerne vermittelt wird: Das klassische Familienbild der bürgerlichen Kleinfamilie, Mama, Papa, Kind. Queere Familienkonstellationen, Adoption, Pflegeelternschaft etc. kommen hier gar nicht vor.
Und die Väter…
Und, das sei an dieser Stelle auch gesagt: Stillen begünstigt natürlich auch eine Aufteilung der Care-Arbeit, in der es die Mutter ist, die nachts aufwacht und in den ersten Monaten nie länger als wenige Stunden vom Kind getrennt sein kann. Muss es aber nicht. Denn der Vater kann auch abgepumpte Muttermilch prima verfüttern. Aus meiner Erfahrung kann man damit nicht früh genug anfangen – wir haben bis zum vierten Monat gewartet und dann sechs Wochen gebraucht, bis sich das Kind an das Konzept Fläschchen gewöhnt hatte und nicht mehr schrie, als werde es Opfer eines Axtmordes. Jetzt, wo das mit dem Fläschchen funktioniert, bin ich wesentlich flexibler und mein Freund freut sich, dass er mit unserem Sohn ausgedehnte Ausflüge machen kann. Sie sind sich viel näher, seitdem es nicht nur ich bin, die füttert.
Vielleicht liegt es daran, dass ein Kind zu versorgen so etwas Urzeitliches ist. Und dass dabei eine zutiefst menschliche Sorge hervortritt: jene, es nicht richtig zu tun, nicht genug Essen zu haben. Mein Freund kennt diese Sorge jetzt auch. Er fühlt sich zuständig, auch für die Ernährung. Und ich glaube, auch so entsteht ein neues Bild von Vaterschaft.
Wenn Stillen gleichbedeutend mit Liebe wäre, wo blieben dann die Väter?