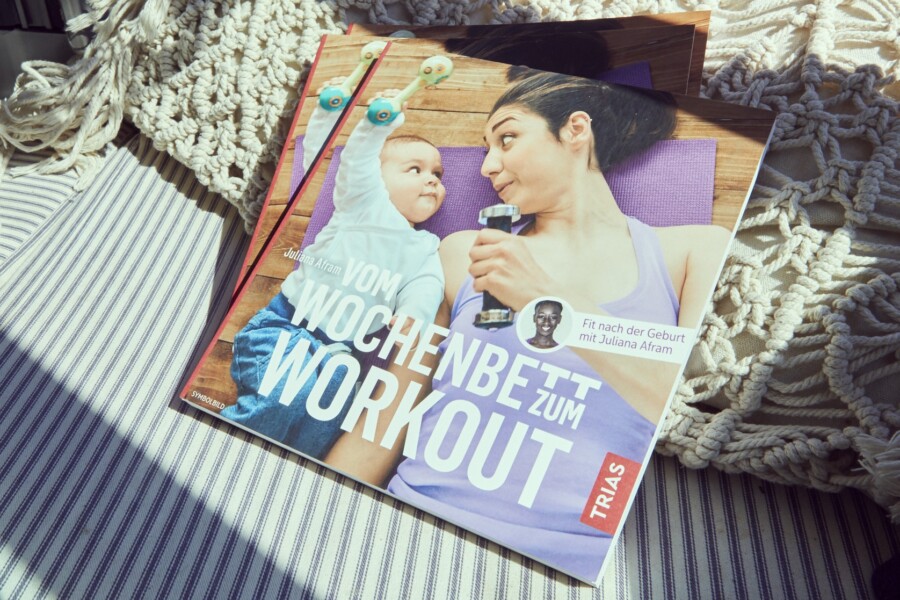Zwischen Wokeness und Wirklichkeit: Sich aufgeschlossen, modern und gleichberechtigt zu fühlen, heißt noch lange nicht, es wirklich und im Zweifel zu sein. Unser Autor Fabian Soethof hat in seiner Kolumne “Papa ante Portas” ein paar Beispiele dafür parat. Auch aus eigener Erfahrung.
Selbst anwesende Väter handeln oft nicht so gleichberechtigt, wie sie denken

Als Alice Hasters 2020 ihr Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ veröffentlichte, traf sie damit einen Nerv. Obwohl aus sehr persönlicher Perspektive verfasst, sprach die Kölner Journalistin stellvertretend für BIPoC, also „Black, Indigenous, and People of Color“, aus, wo, warum und inwiefern sie sich nicht nur im Alltag und strukturell diskriminiert fühlen, sondern nachgewiesenermaßen werden. Im vielleicht augenöffnendsten Kapitel „Nächstenliebe“ schrieb Hasters einen offenen Brief an ihren neuen Freund, der total „woke“ und natürlich gegen Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, weitere Unterdrückung von Marginalisierten und so weiter sei. Im weiteren Verlauf ihrer Beziehung zeichnete Hasters ein Bild davon, inwiefern er als Nicht-Betroffener seine neue Freundin trotzdem niemals so ganz verstehen würde und die Unterschiede zwischen ihnen, wenn es schlecht läuft, eher größer als kleiner würden. So ähnlich, wenn auch in einem ganz anderen gesellschaftlichen Bereich, verhält es sich mit modern gelesenen Vätern. Klar:
Wer nicht gerade der letzte konservative Hinterwäldler ist, behauptet natürlich nicht mehr, dass Frauen in die Küche gehören.
Natürlich sollen ihnen alle Türen so offen stehen wie Männern. Sie sollen gleich verdienen, die gleichen Aufstiegschancen kriegen, sich um Erziehung und Haushalt nicht alleine kümmern. Aber wenn es hart auf hart kommt, sieht die Realität, mindestens aber das Mindset doch noch ganz anders aus. Aus Gründen der Sozialisation, der in der Gesellschaft verankerten Rollenbilder – und aus Egoismus.
In einem weit verbreiteten Zitat beschrieb der Soziologe Prof. Dr. Ulrich Beck das Phänomen schon 1986 als „verbale Aufgeschlossenheit, bei weitgehender Verhaltensstarre“. Bloggerin und Autorin Patricia Cammarata erklärte mir darauf basierend in einem Interview für mein Buch „Väter können das auch“: „Es gibt kein Wissensdefizit, sondern ein Handlungsdefizit“. Und der Väterforscher Andreas Eickhorst kennt auch zumindest eine Teilbegründung dafür: Er nennt sie Anstrengungsvermeidung.
Macht doch mal den Selbsttest: Wie viele Paare in Eurem Umfeld kennt Ihr, die von sich behaupten, sich Kinderkram und Care-Arbeit 50:50 aufzuteilen? Und wenn Ihr dann genauer hinseht: Wie viele von ihnen tun das wirklich? Damit diese gefühlte und bestimmt theoretisch auch gewollte Arbeitsteilung aufgeht, müsste sie in der Erwerbsarbeit genau so aufgeteilt werden. Sprich: Wenn ein Elternteil Vollzeit, der oder die andere in Teilzeit arbeitet, hat erstere*r faktisch weniger Zeit als der oder die zweite. Was natürlich völlig okay ist, wenn beide sich aufrichtig für diese Aufteilung entschieden haben. Wenn Papa aber zum Beispiel argumentiert, dass er ja gar nicht weniger arbeiten könne, weil einer ja das Geld nach Hause bringen müsse oder sein Chef das nicht zuließe, mag das aus rein wirtschaftlichen Gründen stimmen. Er darf dann aber nicht behaupten, seine Partnerin und er lebten ein wirklich gleichberechtigtes Modell. Selbst wenn Paare sich als noch so fortschrittlich sehen, landen nicht wenige von ihnen immer wieder mal in klassischen Aufteilungen. Eine Bekannte schrieb mir neulich dazu: „Mein Mann arbeitet aktuell sehr viel – und dann ist zuhause alles egal. Da liegt die Verantwortung wieder bei mir. Dabei sind wir in normalen Zeiten total gut aufgeteilt.“
Bei mir zuhause läuft es, ehrlich gesagt, mitunter ähnlich: Ich bugsiere Kinder und Kegel durch den Alltag, nehme Arzttermine, Fußballtraining und Co. wahr. Aber ich schwitze schon beim Gedanken an die nächste Urlaubsplanung. Mangelnde Care-Arbeit kann man mir nicht vorwerfen. Liegenlassen und Abschieben von Mental Load durchaus. Es läuft noch viel zu oft und wie bei viel zu vielen Paaren darauf hinaus, dass die Mutter eben doch die letzte Verantwortung trägt. Wir säßen ziellos zuhause rum, wenn meine Frau nicht an die übernächsten Schulferien denken würde. In vielen anderen Familien liegt die finale Entscheidungsinstanz selbst im Tageslevel bei ihr:
Was Papa mal doch nicht macht, wird Mama schon richten.
Hier ein eindeutigeres Beispiel dafür, dass selbst reflektiertere Männer und Väter nur schwer aus ihrer patriarchalen Sozialisation können: Die, die mehr tun als andere, kriegen oft Applaus dafür. Sie nehmen Bühnen ein, die sie auch Frauen überlassen könnten, während die jene Bühnen oft gar nicht angeboten kriegen – oder den Platz nicht annehmen, weil sie sich nicht sicher genug im Thema fühlen oder wegen ihrer Familie keine Zeit dafür zu haben glauben. Als Beleg dieser These reicht ein Blick auf die Talkshowrunden dieses Landes. Paritätische Besetzung sieht in der Regel anders aus. Und wer sich an die viel kritisierte WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ erinnert, in der ausschließlich weiße Menschen wie Micky Beisenherz, Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Jürgen Milski darüber diskutierten, ob wir zum Jägerschnitzel nicht doch noch Z-Schnitzel sagen dürften, weiß, wie das nach hinten losgehen kann – zumindest Beisenherz hätte es besser wissen müssen (und arbeitete dies im Nachhinein auch als einziger glaubwürdig auf). Auch hier nehme ich mich nicht aus: Ich habe gewiss auch deshalb ein Buch über (fehlende) Gleichberechtigung schreiben dürfen, weil ich ein Mann bin.
Und nicht, weil ich darin ausnahmslos Schieflagen benennen würde, über die Frauen sich nicht schon seit Jahrzehnten aufregten. Wären die darin geforderten Dinge so selbstverständlich, wie sie leider noch nicht sind, ich hätte auch einfach machen können, anstatt darüber zu reden und Lesungen zu dem Thema abzuhalten.
Neulich erreichte uns ein gut gemeinter Flyer aus der Grundschule: Berliner Eltern initiierten die an sich sehr unterstützenswerte Aktion „Zu Fuß zur Schule“. Darauf regt ein hipper Vater mit Bart und Tattoos im Superheldenkostüm seinen Arm in die Luft. Auf dessen Rücken thront sein Sohn, die Sprechblase legt ihm die Wörter in den Mund: „Mein Papa ist ein Held!“ Auf der Rückseite wird erklärt, warum der das sein soll: Weil er sein Kind ohne Auto zur Schule bringt und sich dafür Zeit nimmt. Ich verstehe die gut gemeinte Absicht dahinter. Leider aber liegt der Verdacht nahe: Wenn Mama sowas täte, wäre sie keine Heldin. Judith Holofernes fasst diese eigentlich absurde Wahrnehmung im BR-Podcast „Eltern ohne Filter“ jüngst so zusammen: „Meine Mann wird unsere 50/50-Verteilung als heroischer Akt gespiegelt und mir mindestens als potentielle Fehlleistung. Das sitzt tief.“
Wer nun einen Non-Plus-Ultra-Tipp dafür erwartet, wie auch wir ach so modernen Väter uns von Verhaltensstarren und Handlungsdefiziten abseits von Aktionismus lösen, den muss ich enttäuschen. Im Gegenteil: Diesen Tipp oder Zauberspruch hätte ich auch sehr gerne. Aber wie sagte meine Oma damals schon: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht.