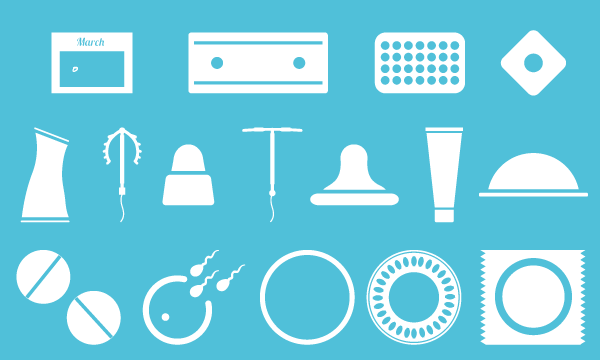Nicht bei allen Menschen passt das bei der Geburt zugeordnete Geschlecht – und manche spüren das schon im Kindesalter. Trans*identität bedeutet, im falschen Körper geboren worden zu sein. Das ist nichts Neues. Neu ist jedoch, dass nun viel darüber gesprochen wird. Und dass es Begleitung und Unterstützung für die Kinder und ihre Eltern gibt. Was wir schlimm finden: Wenn man die Suchmaschinen benutzt, um zu diesem Thema zu recherchieren, landet man sehr schnell auf trans*feindlichen Seiten voll mit falschen Informationen. Deshalb ist es uns wichtig, aufzuklären.
Let’s talk about: Trans*identität bei Kindern und Jugendlichen

Wie viele Kinder sind das schlussendlich, die ihr Geschlecht anpassen wollen? Wie genau verläuft eine therapeutisch begleitete Transition? Braucht es dafür Pubertätsblocker? Können diese einen gesundheitlichen Schaden anrichten? Und: Wie können Mediziner*innen sicher gehen, dass der junge Mensch diese Entscheidung nicht bereuen wird?
Über all das haben wir mit Prof. Dr. Georg Romer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie am Universitätsklinikum Münster gesprochen. Er war einer der ersten Mediziner in Deutschland, der sich mit Trans*identität im jungen Alter beschäftigt und Spezialsprechstunden für Eltern und ihre Kinder angeboten hat. Allein in den letzten acht Jahren hat er über 600 Jugendliche aus ganz Deutschland bei ihrem Transitionsweg begleitet. Wir freuen uns sehr, dass er sich für ein ausführliches Gespräch mit uns Zeit genommen hat. Denn auch er ist der Meinung, es muss viel mehr über Trans*identität geredet werden, um Unwissen, Missverständnisse und Vorurteile abzubauen – und um Toleranz aufzubauen.
Herr Romer, Sie befassen sich seit über 25 Jahren mit der Thematik Trans*identität. Wieso? Damals war das ja noch eher ein Nischenthema und hat noch nicht so den Raum eingenommen wie heute.
Ich war damals Assistenzarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und da kamen hin und wieder trans*idente Jugendliche in unsere Sprechstunde, wobei es noch keine spezielle Sprechstunde für sie gab. Am UKE gab es gleich nebenan die Abteilung für Sexualforschung. Und die hatten irgendwann eine holländische Gastreferentin eingeladen. Das war Peggy T. Cohen-Kettenis – sie galt schon damals als Pionierin in dem Bereich. Sie leitete die Gender-Klinik erst in Utrecht, dann in Amsterdam, heute ist sie pensioniert. Sie sorgte aber federführend dafür pubertätsunterdrückende und geschlechtsangleichende Hormonbehandlungen für Jugendliche zugänglich zu machen. Schon damals stellte sie erste Verlaufsdaten vor, aus denen hervorging, dass trans*idente Jugendliche, die Zugang zu solch einer Behandlung hatten, als Erwachsenene nicht häufiger psychische Gesundheitsprobleme haben als die Durchschnittsbevölkerung. Anders gesagt: Die extrem hohe Suizidrate, die sehr hohe Rate an Depressionen und die ebenfalls hohe Rate an therapieresistenten Langzeitproblem, die man jahrzehntelang bei trans*identen Menschen beobachtet hatte, ließen sich durch solch eine Behandlung senken. Das war ein Donnerschlag für die Fachwelt – und für mich ein Anlass, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Mal ganz naiv gefragt: Was beeinflusst, ob ich trans*ident bin oder nicht? Ist es ähnlich wie bei der sexuellen Ausrichtung – also man ist von Geburt an, wer man ist und wen man liebt…
Exakt. Genau das ist die Antwort. Wir wissen, es gibt eine innerlich angelegte Disposition, die man weder lenken, noch frühzeitig zementieren, noch beeinflussen, geschweige denn „wegtherapieren“ kann. Man ist, wer man ist. Jegliches „Verführungs-Narrativ“ ist hier obsolet. Niemand kann dazu „verführt werden“ homosexuell zu werden, gleiches gilt für die Trans*identität. Auch wenn Herr Putin oder Herr Orbán das nicht glauben.
Wir wissen, es gibt eine innerlich angelegte Disposition, die man weder lenken, noch frühzeitig zementieren, noch beeinflussen, geschweige denn „wegtherapieren“ kann. Man ist, wer man ist.
Man kann als Jugendlicher vielleicht zu einem homosexuellen Abenteuer verführt werden – aber auf Dauer wird sich das nicht durchsetzen, wenn man nicht homo- oder bisexuell ist. Ähnlich ist es bei der Trans*identität: Sicher gibt es Jugendliche, die mal ausprobieren, wie es ist, als Trans*mensch zu leben und nur vorübergehend auf diesen Zug aufspringen. Sind sie es aber nicht, werden sie dabei auch nicht auf Dauer bleiben. Aber ich finde, man sollte sie gewähren und alles ausprobieren lassen. Nur so finden sie heraus, wer sie wirklich sind.
Gibt es Erhebungen, wie viele trans*idente Menschen es in etwa in Deutschland gibt?
Jahrzehntelang ging man davon aus, dass etwa jeder Sechste von 100.000 trans*ident ist. Eine Stockholmer Studie hat jedoch herausgefunden, dass 2 von 1.000 Personen in der erwachsenen Durchschnittsbevölkerung einen starken Wunsch nach einer medizinischen Geschlechtsangleichung in sich tragen. Also 0,2 Prozent. Das ist absolut betrachtet eine hohe Zahl. Münster hat 300.000 Einwohner. Das wären allein hier also 600 Trans*personen mit medizinischem Transitionswunsch. Die Patient*innenzahlen spiegeln das aber noch nicht wieder. Das bedeutet, es kommen noch wesentlich höhere Behandlungszahlen auf das Gesundheitswesen zu.
Wie viele Menschen haben Sie denn schon aufgesucht?
In den letzten acht Jahren haben wir etwa 600 Minderjährige aus ganz Deutschland bei ihrer Transition begleitet. Vor allem in den letzten Jahren ist die Patient*innenzahl steil nach oben gegangen. Das spiegeln auch die Statistiken wider: In den modernen Industriestaaten hat sich die Zahl der minderjährigen Trans*menschen, die spezialisierte Behandlungsangebote aufsuchen, in den letzten fünf Jahren etwa verzehnfacht. Was dabei sehr auffällig ist, ist dass es unter diesen Jugendlichen eine extreme Geschlechterungleichheit gibt: 80 Prozenten der behandlungssuchenden Minderjährigen sind geburtsgeschlechtliche Mädchen bzw. gefühlte Jungs. Bei Erwachsenen ist die Tendenz ähnlich: Da ist derzeit die Zahl sich neu outender Trans*männer pro Jahr doppelt so hoch wie die der Trans*frauen.
Gibt es für diese Diskrepanz einen Erklärungsversuch?
Folgendes wird häufig als Erklärung vorgeschlagen: Unter den Trans*jungen seien besonders viele, die gar nicht trans* seien, sondern eher unter einer diffusen Pubertätskrise bzw. einer Identitätsfindungskrise leiden. Meine Meinung dazu: Das kann sicher vorkommen – ist nach unserer Beobachtung aber eher selten. Für mich ist diese Erklärung, Transidentität als Hype oder Trend besonders bei geburtsgeschlechtlichen Mädchen zu deklarieren daher nicht überzeugend.
Mir scheint folgende Erklärung eher plausibel: Aktuell gibt es zwei sich überlagernde Veränderungen in der Gesamtpopulation. Das eine ist die Vorverlagerung der Outings – die Betroffenen werden also immer jünger. Hinzu kommt, die Outings von Trans*frauen finden, statistisch belegt, im Durchschnitt über die gesamte Lebensspanne zehn Jahre später statt als die der Trans*jungen bzw. Trans*männer. Und das erklärt die aktuelle Situation: Wenn die Trans*männer beim Outing im Schnitt zehn Jahre jünger sind, ist es logisch, dass es unter den Trans*jugendlichen deutlich mehr von ihnen gibt.
Und eine Sache spielt hier auch rein: Trans*mädchen haben bei ihrem Outing viel höhere Hemmnisse zu überwinden als Trans*jungen. Das ist nach wie vor so. Im Kindergarten, in der Schule – das zieht sich durch. Gehänselt wird eher ein sich feminin zeigender Junge im Kleid, als ein burschikoses Mädchen im Kapuzenpullover. Mädchen können sich also viel leichter in einer sozial männlichen Rolle ausprobieren, sich ausleben und kommen so auch früher an ihrem Ziel an. Wenn ich merke, ich werde nach wie vor respektiert und akzeptiert, macht es mein Outing umso leichter. Deutlich wird das auch mit Blick auf die Gewaltstatistiken: Trans*feindliche Gewalt richtet sich häufiger gegen Transmädchen bzw. Transfrauen als gegen Transjungen bzw. Trans*männer. Das erklärt natürlich, warum Trans*mädchen eher mit dem Gedanken hadern, sich zu outen als Transjungen.Wenn sich das irgendwann auflockert – dann könnte sich auch das Zahlenverhältnis vielleicht entsprechend ändern.
Wenn ich merke, ich werde nach wie vor respektiert und akzeptiert, macht es mein Outing umso leichter.
Ich habe gelesen, dass Selbstverletzungen und Suizidversuche häufig unter transidenten Jugendlichen vorkommen. Warum ist das so? Und wie lässt sich das verhindern?
Damit die eigene Trans*identität zu einer lebbaren Perspektive werden kann, müssen Betroffene die Erfahrung machen, dass sie von ihrer Umwelt akzeptiert werden. Bei den meisten Betroffenen ist zudem die Möglichkeit, ihr körperliches Erscheinungsbild dem inneren Empfinden anzugleichen, notwendig. Das heißt, dass der Zugang zu fachgerechten medizinischen Behandlungsangeboten in Verbindung mit sozialer Akzeptanz nachweislich das Risiko für Suizidalität senkt.
Angenommen, ich komme mit meinem Sohn Tim (ehemals Tina), einem 12-jährigen Trans*jungen, zu Ihnen in die Sprechstunde. Wie sieht nun eine typischer Behandlungsweg konkret aus?
Bei einem Ersttermin nehmen wir uns drei Stunden Zeit. Der findet bestenfalls mit beiden Eltern statt. Da wird erst einmal zusammengetragen, was die Familie zu uns geführt hat. Wir sammeln die Narrative ein – wie geht die Geschichte, wie sehen die unterschiedlichen Perspektiven aus, wie sind die Befindlichkeiten und welche Erwartungen, Ängste und evt. Konflikte gibt es.
Eine Trans*entwicklung ist immer eine Familienangelegenheit. Einen solchen Weg kann ein junger Mensch nicht ohne seine Familie gehen. Wenn es mal anders sein sollte ist das immer extrem schmerzlich. Und es ist in aller Regel mit einer Komplettablösung bis hin zum Beziehungsabbruch verbunden und auch nur so zu bewerkstelligen. Alle Daten zu psychischer Gesundheit von Trans*jugendlichen sagen da das Gleiche: Den Trans*jugendlichen geht es gut, solange sie ihr soziales Umfeld, ihre Familie, Freunde, hinter sich wissen.
Nach dem gemeinsamen Gespräch trennen wir Kind und Eltern und sprechen separat mit jedem von ihnen. Wie lange und wie oft diese Gespräche stattfinden, ist ganz unterschiedlich.
Keine Behandlung verläuft also nach Schema F…
Nein. Denn kein Fall ist wie der der andere, immer ist eine sorgfältige und individuelle Prozessbegleitung Bestandteil. Es gibt bei uns keinen Schnellschuss. Niemand kann hier zur Tür reinkommen und am selben Tag mit einem Rezept für Pubertätsblocker herausgehen. Das ist immer eine mehrmonatige Prozessbegleitung, die schließlich in einer sorgfältig abgewogenen Entscheidung mündet, die immer gemeinsam mit dem / der Jugendlichen und seinen / ihren Eltern getroffen wird. Wohlwissend, dass es nie eine 100 prozentige Sicherheit gibt – nicht in der Medizin und auch nicht in anderen Bereichen des Lebens. Aber deshalb zu sagen: Alle Jugendlichen sollen mit der Entscheidung warten bis sie 18, 19 sind, wäre aus meiner Sicht eine komplett unethische Haltung! Das würde so viel Leid verursachen – mitunter auch mit irreversiblen, therapieresistenten, psychischen Langzeitschäden. Das können wir nicht verantworten.

Deutet sich Trans*identität bei Kindern in der Regel im frühen Kindheitsalter an oder kann der Wunsch auch erst plötzlich in der Pubertät aufploppen, sodass sich die Eltern plötzlich verwundert die Augen reiben?
Ja, das gibt es alles. Es ist wichtig zu verstehen, dass es da alle Facetten gibt und man nicht durch die normative Brille schauen sollte – nach dem Motto: Meine Tina hat als junges Kind nicht mit Autos und Bauklötzchen gespielt und nie Fußball gekickt, es kann also nicht sein, dass sie jetzt ein Tim sein möchte. Innere Dispositionen können zu jedem Lebensalter erstmals in Erscheinung treten – bei dem / der einen geschieht das früher, bei dem / der anderen später. Und nichts davon ist unnormal. Aber: Je später der Wunsch auftritt und je länger die „störungsfreie“ Zeit vor dem Wunsch andauerte, umso mehr Zeit müssen wir als Therapeuten uns mit der Familie nehmen – auch, um einer möglichen Detransition vorzubeugen. Wir müssen den Jugendlichen / die Jugendliche also genau kennenlernen, um sicher zu gehen, dass er /sie anhaltend trans*ident ist und er / sie nicht beispielsweise nur unter einer diffusen vorübergehenden Identitätskrise leidet.
Wie hoch ist denn die Zahl der sogenannten Detransitionierer, also derer, die ihre Transition irgendwann bereuen?
Die ist sehr, sehr gering – und trotzdem müssen wir in jedem Fall ganz genau hinsehen. Fakt ist: Bis zur Pubertät lassen sich keine konkreten Vorhersagen treffen. Bei Kindern irgendwelche Prognosen oder Diagnosen zu stellen, halte ich für unseriös. Daher spreche ich auch nicht von “Transkindern”, sondern nur von “geschlechtsdiversen Kindern”. In dem jungen Alter lässt sich nicht sicher vorhersagen, ob sich ihr Wunsch in der Pubertät noch einmal verändert oder nicht. Erst dann kann man sagen, wo die Reise hingeht. Aber: Es spricht nichts dagegen, dem Kind tagtäglich zu vermitteln, dass so wie es ist, wunderbar ist und das Kind darin zu bestärken, sich in der Rolle, die es im sozialen Umfeld annehmen möchte, auszuleben. Bei Kindern gibt es noch keine Trennschärfe zwischen Geschlechtsrolle und Geschlechtsidentität. Das Unbehagen mit der Geschlechtsrolle ist nur EIN Begleitphänomen einer Trans*identität. Das wird sehr oft missverstanden.
Es spricht nichts dagegen, dem Kind tagtäglich zu vermitteln, dass es so wie es ist, wunderbar ist und das Kind darin zu bestärken, sich in der Rolle, die es im sozialen Umfeld annehmen möchte, auszuleben.
Was bedeutet das konkret?
Auch wenn das selten vorkommt: Wenn man Jugendliche davor schützen will, auf einen „Trans*-Zug“ aufzuspringen, sollte man sie erst recht dazu ermuntern, sich auszuprobieren. Erst wenn sie sich in der anderen Geschlechtsrolle sozial ausleben können, bekommen sie ein Gefühl dafür, ob sie das, was sie nun leben auch wirklich sind – oder ob sie nur in einem Rollenkonflikt feststecken, der nichts mit Trans*identität zu tun hat. Und diese Differenzierung kann man erst im Jugendalter erfassen und noch nicht als Kind.
Jugendliche, die ein Probe-Outing mitmachen und dann feststellen, sie wollen doch wieder zurück zu ihrem ursprünglichen Geschlecht, sagen oft, das zweite Outing sei deutlich schwerer gewesen. Weil sie Angst hatten, der Trans*-Communitiy mit ihrem Verhalten zu schaden, indem sie vermitteln, sie seien nur einem Trend gefolgt. Das kann Hemmnisse schaffen. Aber die lassen sich durch Toleranz und gesellschaftliche Aufklärung abbauen, indem man die Kinder und Jugendlichen immer wieder ermuntert, ihren eigenen Weg zu finden.
Kritisch wird es erst dann, wenn wir mit medizinischen Interventionen die Geschlechtsangleichung angehen. Dann sollten die Prozesse der Rollenerprobung soweit fortgeschritten sein, dass man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen kann, dass später keine Rolle rückwärts erfolgt. Eine 100 prozentige Sicherheit wird man dabei aber nie haben können!
Okay, kehren wir zurück zu der Frage, wie ihre Prozessbegleitung im Fall meines 12-jährigen Sohnes Tim nun weiter aussieht.
Wir führen also über mehrere Termine intensive Gespräche mit dem Jugendlichen. Den Eltern und ihren möglichen Zweifeln, Vorbehalten und Fragen geben wir dabei einen separaten Raum – damit diese offen ausgesprochen werden können, ohne die Jugendlichen zu verletzen. Wir wollen den Eltern dabei auch die Angst nehmen, sich falsch zu entscheiden.
Ab wann beginnt dann die Einnahme von Pubertätsblockern?
Das muss nicht zwangsläufig erfolgen und ist immer abhängig vom Leidensdruck. Die Frage ist ja: Inwiefern kann Tim überprüfen, nicht doch „nur“ ein Tom-Boy zu sein, also ein burschikoses Mädchen mit vermehrt männlichen Interessen? Oder ob er tatsächlich trans*ident ist? Zu Beginn der Pubertät muss also genau geprüft werden, ob Tim in seiner Rolle als „Tom-Boy“ aufgeht und keinen Leidensdruck hat. Oder ob er mit seinem Körper in Dauerkriegszustand steht. Das muss man eine Weile beobachten. Wir würden also niemals ein sogenanntes „Trans*kind” vor Eintritt der Pubertät mit Pubertätsblockern behandeln. Aber: Wenn die Pubertät erreicht ist, die soziale Akzeptanz im Umfeld hergestellt ist, aber das Leid am eigenen Körper andauert – dann sind die Pubertätsblocker eine Behandlungsoption, die wir anbieten. Mit der Maßgabe, dass das ein vorläufiger Schritt ist, um irreversible Veränderungen des Körpers zu verhindern. Das muss sehr gut bedacht werden. In den frühen Phasen einer Geschlechtsdysphorie ist der Einsatz dieser Mittel relativ harmlos – je später man diese Mittel verabreicht, wird es umso schwieriger. Solch eine Entscheidung – Pubertätsblocker ja oder nein – , ist also immer eine Einzelfallentscheidung.
Gibt es ein Mindestalter für die Hormongabe?
Nein, die gibt es nicht mehr. Früher lag die Grenze bei 16. Aber das hat man aufgehoben, da der Reifeprozess bei den Jugendlichen zu unterschiedlichen Zeiten einsetzt. Bei manchen beginnt er schon mit 12 – aber niemand kann verantworten, den Jugendlichen vier Jahre lang, bis sie 16 sind, Pubertätsblocker zu verabreichen. Diese dürfen immer nur über einen überschaubaren Zeitraum eingenommen werden, zur Überbrückung. Laut Empfehlungen der Endokrinologen liegt die Obergrenze bei maximal zwei Jahren. Wir versuchen die Pubertätsblockade aber so kurz wie möglich zu halten, sie sollte nur genutzt werden, um sich völlig klar zu werden, wohin die Reise hingehen soll. Denn je früher man danach mit der hormonellen Geschlechtsangleichung beginnen kann, umso gesünder ist es für den Körper. Dieses Abwägen muss man individuell aushandeln. In der Regel liegt die Verabreichung von Pubertätsblockern zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Das kann man gut vertreten. Würde man sie in der Zeit absetzen, würde die Reifeentwicklung komplett reversibel unbeschadet weitergehen.
Die Vorbehalte gegen Pubertätsblocker sind also absolut unbegründet?
Ja, vorausgesetzt man verabreicht sie fachgerecht. Tatsächlich ist es eine hochkomplexe Intervention in den Körper. Und würde man die Mittel schrotschussartig einsetzen, würde ich all die Bedenken auch verstehen und teilen. Bei fachgerechter Anwendung durch einen erfahrenen Kinderendokrinologen, der den Prozess sorgfältig begleitet und den jungen Körper nicht unnötig lange diesen Mitteln aussetzt – also so kurz wie möglich und so lang wie nötig – halte ich das für den richtigen und auch sinnvollen Weg.
Unter all den 600 Jugendlichen, die wir hier behandelt haben, gab es einen Trans*jungen, der sich nach zwei Jahren Pubertätsblockade, schließlich doch gegen die anstehende Einnahme von Testosteron entschieden hat, weil sich das für ihn letztlich falsch anfühlte. Er trug noch zwei Jahre den männlichen Namen, nahm dann aber wieder seinen weiblichen Vornahmen an – und bezeichnet sich heute als non-binär. Dieser junge Mensch ist also seinen Weg gegangen, ohne dabei einen Schaden erlitten zu haben.
Nicht alle Mediziner teilen Ihre Ansichten. Es gibt Stimmen, die dafür plädieren, gar keine Pubertätsblocker einzusetzen, sondern abzuwarten. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sprachen Sie in dem Zusammenhang vom so genannten „Irreversibilitäts-Dilemma“. Was genau meint das?
Das beschreibt die Ebenbürtigkeit vorzunehmender eine ethischer Abwägungen. Die Ethiker sagen zum einen, wir Mediziner haben eine hohe ethische Begründungslast und eine immense Verantwortung, wenn wir in einen biologisch gesunden jungen Körper hormonell eingreifen, mit irreversiblen Folgen. Aber: Die ethische Begründungslast ist genauso hoch, wenn wir zu lange abwarten und den Jugendlichen ins offene Messer einer fortschreitenden Reifeentwicklung mit irreversibler Vermännlichung bzw. Verweiblichung des Körpers laufen lassen. Also wenn wir zulassen, dass sich das geschlechtsdysphorische Leid weiter chronifiziert und damit immense Auswirkungen auf die psychische Langzeitgesundheit hat.
Diese Ebenbürtigkeit dieser zwei Seiten hat mich, seitdem ich mich mit Trans*identität befasse, nicht losgelassen und ich war und bin der Meinung, es muss in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Behandler*innen geben, die da in die Verantwortung gehen, weil wir uns dem nicht einfach entziehen können. Abzuwarten bis Trans*jugendliche erwachsen sind, ist keine neutrale Option! Und im Kern entspricht diese Haltung weitestgehend der Adhoc-Empfehlung, die der Deutsche Ethikrat 2020 veröffentlicht hat. Ich bin sehr froh über diese Empfehlung, weil es endlich ein Papier gibt, an dem sich Behandelnde in ihren Abwägungen orientieren können.
Abzuwarten bis Trans*jugendliche erwachsen sind, ist keine neutrale Option!
Ich sage hierzu: Wer die medizinische Behandlung trans*identer Jugendlicher kategorisch ablehnt, ohne dabei auf den individuellen Fall zu schauen, outet sich als Ideologe. Man kann Bedenken äußern, aber man sollte keine Pauschalurteile fällen.
Lieber Herr Prof. Dr. Romer, haben Sie herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch!
Titelfoto: Mercedes Mehling
Wenn ihr euch weiter informieren wollt: Nora Imlau hat auf ihrer Instagram Seite ein Highlight zu Trans*identität angelegt.
Auch die folgenden Lesetipps stammen von ihr:
12 Antworten auf Fragen zum Thema Selbstbestimmungsgesetz und Trans*geschlechtlichkeit vom Bundesverband Trans*
Info-Artikel “Jung und trans*” vom Regenbogenportal
“James meint es ernst” – Erfahrungsbericht einer Familie