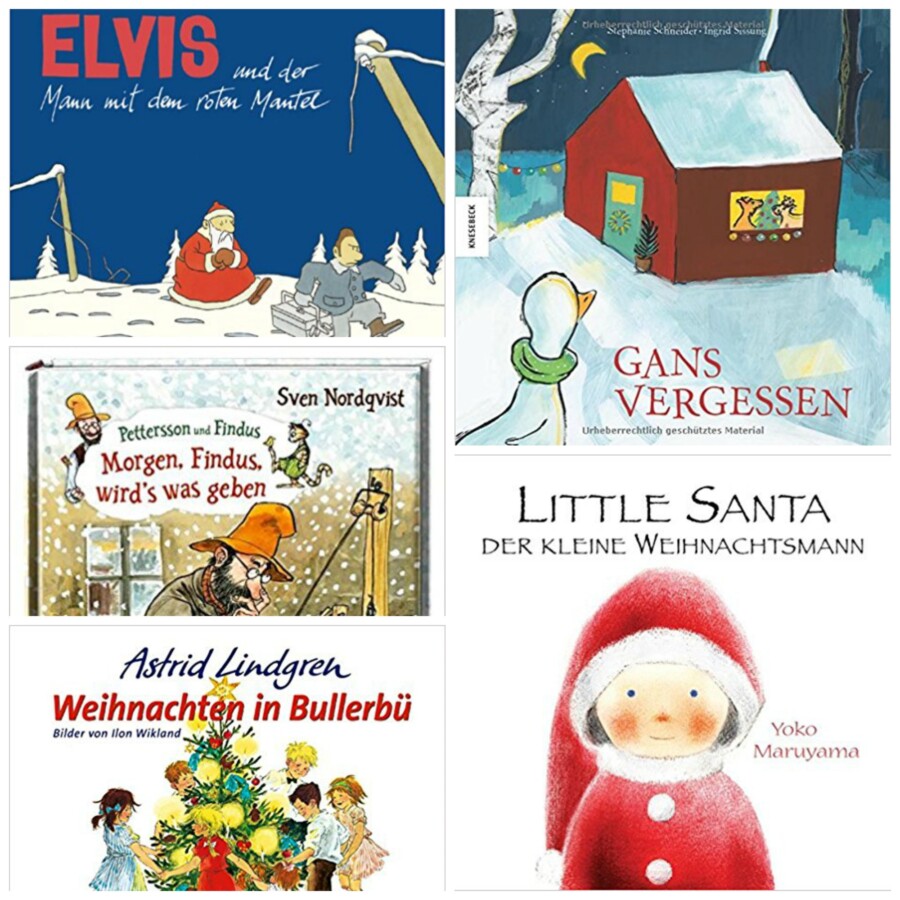Am Ende der Frieden (mit den eigenen Eltern)

Dieser Freund ist mir gefühlt immer irgendwie voraus gewesen. Er sprach etwa, als wir uns vor rund zehn Jahren kennenlernten, er wisse nicht, warum er zu arbeiten beginnen solle, ehe er 40 würde. Er sprach von den Farben des Frühlings, dem Licht im Fenster sitzend zugewandt. Er zwang mich, vor seiner Anlage sitzend Klavierkonzerten schweigend zuzuhören – die Zeit, die Worte, das draußen einmal nur sein zu lassen.
Er hatte ihnen schlichtweg verziehen und viel mehr noch zu einem Gefühl zu ihnen zurückgefunden: Dankbarkeit.
Und: Er fuhr seine Mutter regelmäßig gleichmütig gestimmt besuchen, während ich kategorisch “meine-Mutter-mein-Vater”-Schuldabtretungsmonologe unternahm, wenn es galt, mich für #wasauchimmer zu rechtfertigen und ein jedes Mal grollte, sobald die Stimme meiner Eltern am Telefon erklang.
Die Grundlage der Beziehung zu seinen Eltern ist ursprünglich unterdessen keine bessere als die meine. Er hatte ihnen schlichtweg verziehen und viel mehr noch zu einem Gefühl zu ihnen zurückgefunden: Dankbarkeit.
Ich will hier dazu auch gar nicht viel mehr schreiben, als dass genau das so langsam von der Theorie in meiner emotionale Praxis ankommt. Ich habe den Eindruck, nach vielen Jahren der inneren Aufruhr endlich an dem Punkt angelangt zu sein, an dem ich meine Eltern in dem, was sie taten, nicht nur verstehen kann, sondern auch wieder anzuerkennen weiß, was lange hinter dem Groll verschütt geraten war: die guten Anteile an ihrer Mitgift für mein Leben.
Inzwischen kann ich auch sehen, welchen Anteil ich an “uns” hatte – dass Beziehungen, auch zwischen Kindern und Eltern, immer in der Begegnung zweier Parteien zu verstehen sind. Dass niemand nur schuldig ist und niemand nur Opfer – bzw., dass Opfer gewisser Weise auch immer Täter, so wie Täter immer auch Opfer sind.
Ich verstehe, dass mein Vater wie meine Mutter das ihnen bestmögliche unternommen haben, mir gute Eltern zu sein – und dass in diesem Konzept ihre emotionalen Schranken berücksichtigt werden wollen, die eben auch ihre eigenen Wunden beschreiben.
Ein Kind versteht sich nicht nur in Relation zu seinen Eltern. Es ist immer auch ein eigenständiger Mensch.
Und letztlich ahne ich über die Begegnung zu meinem Sohn, dass Eltern letztlich viel weniger ausschlaggebend für das Wohlergehen, die Entwicklung eines Kindes sind, als sie immerzu meinen (und sich damit gewisser Weise auch überhöhen in ihrem Einfluss). Als bestimme sich das Leben eines Menschen nur ob des Schoßes, aus dem er entsprungen ist. Als sei das Kind seinen Eltern nur ausgeliefert, als gäbe es keinen Ausweg, nur die Sackgasse – als wüsste sich ein Kind nicht zu entscheiden, sich nicht unabhängig zu entwickeln. Als bedinge sich das Kind, der Mensch ausschließlich in seiner Herkunft.
Ich glaube das jedenfalls für mein eigenes Kind genauso wenig wie für mich inzwischen. Ich präge meinen Sohn anteilig sicher, so wie meine Eltern mich geprägt haben. Aber er wird daraus hervorgehen, so wie ich daraus hervorgegangen bin. Er wird sich mir gegenüber entwickeln und verhalten, wie es für ihn gut und richtig ist – so wie ich mit meinen Eltern war und ich es nicht anders sein konnte, um zu werden, was und wer ich heute bin.