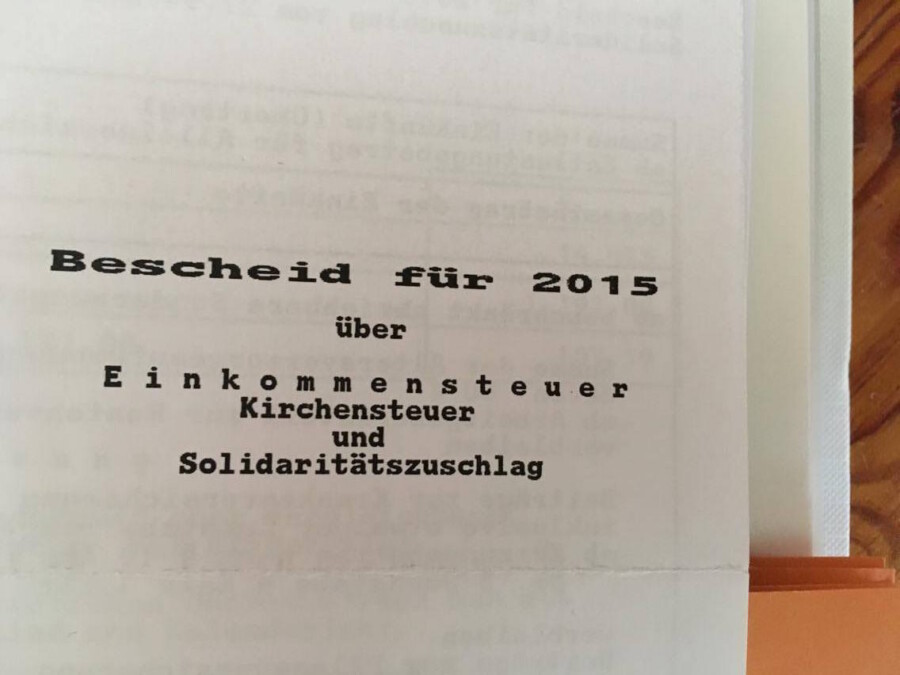Der Gang zur Feindiagnostik während der Schwangerschaft ist mittlerweile völlig normal geworden – und auch der so genannte “Pränatest” hat sich weitestgehend durchgesetzt. Kinder mit Down-Syndrom werden in unserer Gesellschaft also immer seltener. Oft, weil die Eltern sich nicht bereit fühlen für ein Kind mit Behinderung. Oder weil sie Angst davor haben, dass ihr Leben dann nur noch aus Verantwortung und Pflichten besteht, oder das Leben für das Kind nicht „lebenswert“ sein könnte. Zum Glück gibt es Mütter wie Esther, die einen ganz anderen Blick haben. Esther lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Zwillings-Töchtern (7) und ihrem Sohn (2), der mit dem Down-Syndrom geboren wurde, in der Nähe von München in den Alpen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Fotografin in Form von wunderschönen Bildern ihren 85.000 Followern, wie viel Liebe ihr geschenkt wurde. Ein herzerwärmender Account, der den Blickwinkel auf das Leben mit Trisomie21 ins richtige Licht rückt. Ich habe mir schon lange gewünscht, sie mal zu interviewen – und letzte Woche hat es endlich geklappt!
„Ich möchte ein anderes Bewusstsein für Menschen mit Down-Syndrom schaffen“

Bei meinen Vorbereitungen auf das Interview habe ich gemerkt, wie unsicher ich bei der Wortwahl bin und das ich automatisch Angst habe, etwas Falsches zu sagen oder vielleicht zu unsensibel zu sein. Kennst du diese Berührungsängste?
Ich kann das total verstehen, denn selbst mit einem Kind mit Behinderung gibt es am Anfang Unsicherheiten und ich habe mich damals auch gefragt, ob ich denn zum Beispiel einfach so „behindert“ sagen kann. Aber zu Hause benutzen wir diese Begriffe völlig selbstverständlich. Auf Instagram wiederum bin ich dann doch etwas vorsichtiger, was ich schreibe und welche Wortwahl ich benutze. Man wächst da über die Zeit rein und es ist ein Prozess, der sich auch verändern darf.
Hattest du vor der Geburt deines Sohnes schon Kontakt mit Menschen mit Einschränkungen?
Ich komme aus einer Familie, in der Behinderungen eine große Rolle spielen. Meine Eltern haben sich in den 70er Jahren quasi in einem Behindertenheim kennengelernt – meine Mutter hat während der letzten 40 Jahre immer wieder mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Schon als ich Kind war hatten wir zu Weihnachten meist Besuch von einem Freund der Familie, der geistig behindert ist und auch jetzt zu Weihnachten immer noch kommt. 2020 gestaltete sich das das allererste mal seit Jahren anders. Ich bin also schon mit dem Thema groß geworden. Vor sechs Jahren hat eine meiner Schwestern ein behindertes Kind bekommen, sodass ich auch da hautnah mitbekommen habe, wie es ist mit einem Kind mit Behinderung zu leben. Zusätzlich habe ich auch nach meinem Sozialpädagogik-Studium in der Schwangeren- und Familienberatungsstelle gearbeitet und mich viel mit dem Thema Pränatal-Diagnostik beschäftigt und eigentlich damals schon, vor zehn Jahren, Petitionen geteilt, die gegen die Bluttests waren, die heute ziemlich selbstverständlich sind.

Das klingt fast so, als wäre eure Familie dazu berufen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen!?
Das hab ich mich kurz nach der Geburt meines Sohnes natürlich auch irgendwann gefragt. Auch mein Mann meinte: „Esther, du hast dich schon immer für diese Menschen eingesetzt, dass mir sogar schon mal der Gedanke kam, ob du dir nicht so ein Kind vielleicht auch gewünscht hast?“ Aber natürlich wusste ich durch meinen Neffen, dass ein Leben mit einem behinderten Kind viel Anstrengung und ja, auch Ablehnung und Mitleid seitens der Gesellschaft bedeutet. Deshalb kann man nicht sagen, dass der Wunsch da war, aber ich habe schon immer ein sehr großes Herz für eben diese Menschen gehabt und mich hat es immer gestört, dass sie oft ausgegrenzt werden. Das Thema war also seit je her sehr präsent bei mir und JA: Vielleicht ist das jetzt einfach unsere Mission.
Wann hast du davon erfahren, dass dein Sohn den Gendefekt Trisomie 21 in sich trägt?
Ich wusste es weder in der Schwangerschaft, noch direkt nach der Geburt. Ich erinnere mich noch genau, wie mein Sohn auf die Welt kam und wir fanden, dass er soooo so hübsch ist. Wir haben einfach nur einen perfekten, kleinen Jungen gesehen. Dann schießen natürlich auch noch die Hormone ein, und ich habe nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass mit unserem Sohn etwas nicht in Ordnung sein könnte. Er war zwar relativ schwach, hat die Augen nicht aufgemacht und war total verschlafen, aber wir haben halt einfach gedacht, dass er noch einen Moment braucht, schließlich kam er ein paar Tage vor seinem errechneten Entbindungstermin auf die Welt. Erst bei der U2 am dritten Tag kam nach der Untersuchung eine Ärztin auf uns zu, und meinte sie würde gerne mal mit uns reden. Sie hat wahnsinnig rumgedruckst, kam nicht zum Punkt und als dann der Satz fiel „Ich muss ihnen jetzt was sagen und das tut mir jetzt so leid“, dachte ich wirklich, sie sagt uns jetzt, dass unser Kind stirbt. Schlussendlich erklärte sie zögerlich, dass der Verdacht besteht, dass unser Sohn das Down-Syndrom haben könnte. Ich war nicht nur geschockt in dem Moment, sondern auch wütend, dass sie das in so einem mitleidigen Tonfall gesagt hat. Sie war natürlich einfach nur unsicher – und woher sollte sie auch wissen, dass für mich damit nicht die Welt untergeht. Trotzdem: Unsicherheit oder Nichtwissen hin oder her, aber wie wär’s, wenn medizinisches Personal die Freude über ein gerade geborenes Menschenleben, den wertvollen Gedanken eines jeden Lebewesens zuerst in den Vordergrund rücken würde? Wie ich später erfahren habe, ist das wohl leider kein Einzelfall. Viele Eltern von Kindern mit Trisomie 21 berichten, dass sie erlebt haben, dass es dem Krankenhauspersonal wohl häufig schwer fällt, die Diagnose feinfühlig zu übermitteln.

Was wäre denn für euch als Eltern in dieser Situation nach der Geburt wirklich hilfreich gewesen?
Dass mir ein anderes betroffenes Elternteil sagt: „Weißt du was, du wirst dieses Kind so sehr lieben, das kannst du dir gar nicht vorstellen!“ Deshalb bin ich so dankbar, dass Lara von @vonmutterzumutter eine wunderbare Broschüre entwickelt hat, die für Eltern ist, die in der Schwangerschaft oder nach der Geburt von der Diagnose überrascht werden. Die Hefte werden mittlerweile in ganz Deutschland und auch teilweise in Österreich und der Schweiz verteilt. Auch an Krankenhäuser und Kreissäle, damit das Krankenhauspersonal diese im Fall der Fälle verteilen kann und die Eltern sich von persönlichen Berichten anderer T21-Eltern ermutigen lassen können.
Ich selber bekomme ja auch wahnsinnig viele Anfragen von Müttern oder von Freundinnen der Mütter, die diese Diagnose bekommen haben. Dann weise ich auch immer auf diese tolle Broschüre hin, weil sie einfach wirklich richtungsändernd sein kann.
Wie ging es dann weiter nach der Geburt? Wie waren die ersten Wochen für euch und was geht einem alles durch den Kopf?
Ich glaube, wir haben damals die Diagnose zunächst ganz unterschiedlich verarbeitet. Ich war – wie schon gesagt – wahrscheinlich auch durch die Hormone, einfach nur ganz doll verliebt in meinen Jungen. Ich habe einfach nur dieses perfekte Baby gesehen und wollte mir das auch nicht nehmen lassen. Und ich war total froh, dass meine Erfahrung mit Behinderten mich schon so geprägt hatte und ich darin keine Belastung, sondern sogar eher eine Bereicherung gesehen habe. Auch wenn ich natürlich wusste, wie anstrengend es werden kann, aber mein Wochenbett wollte ich mir nicht nehmen lassen und konnte die Babyblase tatsächlich in vollen Zügen genießen. Ich höre auch jetzt noch die eine tolle Ärztin aus dem Krankenhaus in meinem Ohr, die sagte: „Er ist ein Baby wie jedes andere, das einfach geliebt und umsorgt werden will. Nichts weiter.“
Für meinen Mann wiederum war es anfangs schwerer, als wir das Ergebnis dann Schwarz auf Weiß hatten. Er war die ersten Wochen direkt in diesem „sich vom normalen Kind verabschieden- Prozess“ drin. Es gab sehr viel zu verarbeiten und man muss sich einfach verabschieden von den Vorstellungen, die man vielleicht von einem „normalen“ Baby hatte. Da spielt Trauer auf jeden Fall eine Rolle und kritische Fragen, die man sich stellen muss. Bei mir kam diese Phase dann erst ein wenig später – und das war auch gut so. So konnte einer von uns die Familie am Laufen halten, während der andere Zeit für sich hatte, um zu verarbeiten. Und dennoch war uns immer wichtig, im Gespräch zu bleiben und dieses auch miteinander zu suchen. Auch wenn es nicht immer einfach war. Aber zu wissen, dass eine Verabschiedungsphase vom „normalen“ Kind quasi normal und ganz natürlich ist, hatten wir ja auch schon bei meiner Schwester beobachten können. Und dann ist da eben dieses Baby, das einen anschaut mit einem Blick voller Liebe… er hat uns, wie gesagt, von der ersten Minute an verzaubert – und wir sind alle furchtbar verliebt in ihn.

Stellt man sich dann auch direkt Zukunftsfragen oder lebt man erst mal nur im Jetzt?
Natürlich stellt man Fragen an die Zukunft, deshalb hab ich dann auch recht bald Kontakt zu einer alten Bekannten aus meiner Jugend aufgenommen, von der ich wusste, dass sie eine zehnjährige Tochter mit Down-Syndrom hat. Die hat sich total gefreut und konnte mir natürlich ganz viel berichten und mich in vielen Punkten auch beruhigen. Sie ist ein großes Geschenk für mich gewesen. Vor allem ihre Gelassenheit, die total wichtig ist, um im Moment zu leben. Bei jedem Treffen strahlt sie das für mich aus: dieses “sich nicht schon Gedanken zu machen, wie was in zehn Jahren sein könnte…” Aber ich denke, wir beide haben da auch dieses Gottvertrauen, dass unsere Kinder ihren Weg gehen werden und es jemanden gibt, der einen guten Plan für sie bereit hält. Es bringt nichts, jetzt schon über die Pubertät nachzudenken, das mache ich ja bei meinen Töchtern auch nicht. Man darf Vertrauen haben, dass alles so kommen wird, wie es soll.
Du bist seit sechs Jahren aktiv auf Instagram – was findet man auf deinem Account?
Auf Instagram zeige ich Ausschnitte aus unserem Leben. Momentaufnahmen. Dinge, die mich persönlich zum Staunen, zum Innehalten und zur Dankbarkeit in meinem Alltag führen.
In unserem Leben dreht sich sehr viel um Natur, die Berge und die Familie. Das habe ich natürlich mit meinem Sohn weitergeführt. Mir war es schon immer ein großes Anliegen, Menschen in ihrer Schönheit mit meiner Kamera festzuhalten und wenn diese Schönheit dann auch noch von innen kommt und sie richtig zu spüren ist, dann entstehen wunderbare Bilder. Und das war mir eben so wichtig, dass diese Schönheit auch mit einem behinderten Kind weitergeführt wird. Ich wünsche mir, dass mein Account dazu beiträgt, dass dieses veraltete Bild von Menschen mit Down-Syndrom, das oft noch in den Köpfen festsitzt, aufgehoben werden kann und ein neues Bewusstsein geschaffen werden kann. Und ja, ich möchte zeigen, dass auch auf Social Media, das Perfekte im scheinbar Unperfektem liegt.

Die perfekte Welt gibt es nicht, auch wenn Instagram so tut, aber ich kann mir mein Leben ja so positiv wie möglich gestalten und mit Liebe füllen. Und mein Sohn hat unser Leben mit so viel Liebe gefüllt, dass es mir wichtig ist, das zu zeigen – das Leben hört ja nicht plötzlich auf, nur weil man ein behindertes Kind hat – ganz im Gegenteil. Oftmals wird einem dann erst so richtig klar, welche Werte, welche Prioritäten wirklich wichtig sind. Wir sind damals trotzdem mit unserem Bus, unseren Töchtern und unserem fünf Monate alten Sohn, fünf Monate auf Reisen gewesen und haben unser Leben nicht komplett umgestellt nur wegen seines extra Chromosoms. Ich hab ehrlich gesagt auch gar keine Lust, dass sich unser ganzes Leben jetzt nur noch um seine Behinderung drehen soll, wir sind schließlich fünf Familienmitglieder – und jeder von uns hat eigene Bedürfnisse, er gehört einfach selbstverständlich dazu.
Auf deinem Account spürt man diese besondere Liebe zwischen deinem Sohn und dem Rest der Familie richtig. Kannst du das beschreiben?
Oft habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich diese besondere Liebe gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Ich glaube, dass Kinder mit Behinderungen oftmals so eine besondere, ungefilterte, pure Liebe ausschütten und ausstrahlen. Das ist auch das, was andere betroffene Eltern mir berichten. Und manche Freunde von uns, die unseren Sohn kennengelernt haben, sagten danach: „Esther, irgendwas hat dein Sohn mit mir gemacht – der hat mich wie verzaubert.“ Diese bedienungslose Liebe, die von ihm ausgeht, ohne zu werten, ohne dass man vor ihm etwas darstellen muss, das hinterlässt wirklich Eindruck. Und eigentlich ist das ja auch genau das, was wir uns letztendlich für uns selbst wünschen – nicht bewertet zu werden, sondern einfach so geliebt zu werden, wie wir sind. Alleine deswegen wünschte ich einem jeden Menschen so jemanden wie meinen Sohn an seiner Seite.

Was wünschst du dir von der Gesellschaft im Umgang mit Behinderung?
Ich möchte meinen Sohn bedingungslos lieben und so annehmen wie er ist. Ich weigere mich, mit ihm jeden Tag zu irgendeiner Therapie zu laufen, bloß damit er besser ins System passt und „so normal wie möglich wird“, ja vielleicht „weniger behindert“ ist – das stelle ich hier mal provokativ in den Raum. Ich merke, ich bin da skeptisch und frage mich schnell, wenn ich Eltern mit Kindern mit Behinderung erlebe, die sie von einer Therapie zur nächsten schleppen und eine Methode nach der anderen ausprobieren, was die Motivation dahinter ist. Ob es wirklich darum geht, dem Kind zu helfen, sein Potential auszuschöpfen, Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit zu erfahren – oder ob es mehr in die Richtung geht, den anderen oder der Gesellschaft beweisen zu müssen, dass unsere behinderten Kinder gar nicht so behindert sind?
Ich möchte nichts beweisen müssen. Nein. Ich wünsche mir bedingungslose Akzeptanz von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Ein solidarisches Denken. Ein Miteinander. Ich wünschte mir, dass Selbstständigkeit nicht das höchste Gut ist und fände es wunderbar, wenn „Helfen“ nicht als Schwäche empfunden wird, sondern als Stärke. Wenn das „Miteinander“ mehr Anerkennung findet als das „Alleine“. Ich möchte, dass mein Sohn spürt, dass er genau so richtig ist, wie er ist. Denn gerade Kinder mit einer Behinderung sind wahnsinnig sensibel und spüren, wenn man sie zu sehr „verändern“ möchte. Um so wichtiger ist es, dass die Gesellschaft Platz macht, für Kinder die nicht ins System passen – und nicht umgekehrt.
Danke, Esther!!
Fotos: Esther Meinl Zottl @ourlifeinthealps